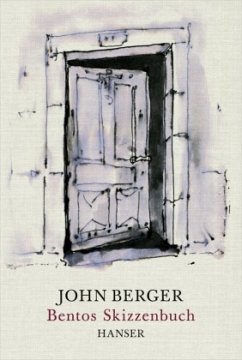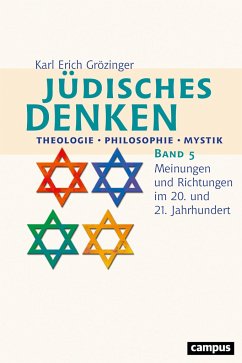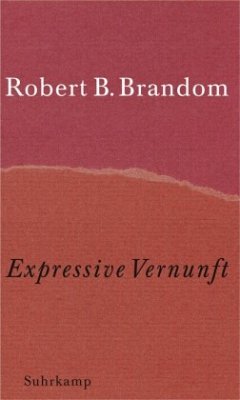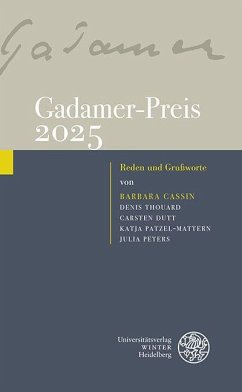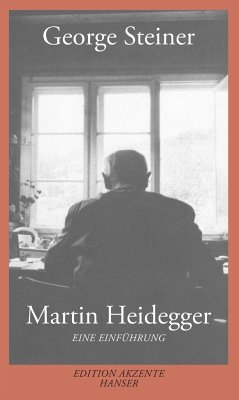Peter Sloterdijk
Die Kunst des Philosophierens
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
24,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Kein anderer Philosoph polarisiert so stark wie Peter Sloterdijk. Seine Thesen zur Zukunft der Gesellschaft und Politik, der Religion und Kultur haben immer wieder heftige Debatten ausgelöst und der Philosophie zu neuer gesellschaftlicher Bedeutung verholfen. Hans-Jürgen Heinrichs liefert nun zum ersten Mal eine umfassende Deutung von Sloterdijks immensem Werk, verknüpft mit den Etappen seines persönlichen Werdegangs. Dieses Buch wird schon bald unentbehrlich für die Auseinandersetzung mit Sloterdijks Philosophie und ihrer Bedeutung für das zeitgenössische Denken sein.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.