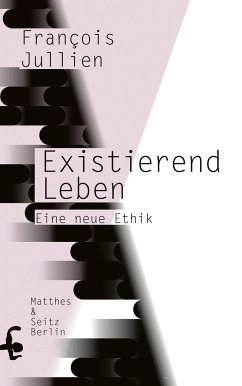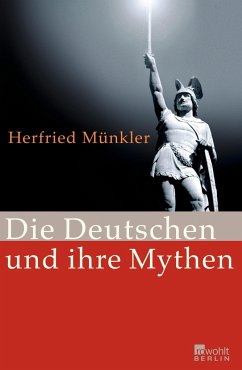Philosophie der Bürgerlichkeit
Die liberalkonservative Begründung der Bundesrepublik
Herausgegeben: Nolte, Paul; Hettling, Manfred

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Bundesrepublik besitzt eine nachträgliche intellektuelle Begründung. Sie ist sichtbar in einer bürgerlichen Haltung, die sich mit dem westdeutschen Staat in seinen Grundsätzen identifizierte. Philosophisch wurde diese Position vor allem von einem Kreis um Joachim Ritter formuliert, zu dem Hermann Lübbe, Odo Marquard und auch Robert Spaemann gehörten.Ihre Philosophie der Bürgerlichkeit beschreitet einen eigenständigen ideengeschichtlichen Weg und liberalisiert die konservativ-antidemokratischen Vorstellungen eines Carl Schmitt und Arnold Gehlen. Jens Hacke rekonstruiert diese politi...
Die Bundesrepublik besitzt eine nachträgliche intellektuelle Begründung. Sie ist sichtbar in einer bürgerlichen Haltung, die sich mit dem westdeutschen Staat in seinen Grundsätzen identifizierte. Philosophisch wurde diese Position vor allem von einem Kreis um Joachim Ritter formuliert, zu dem Hermann Lübbe, Odo Marquard und auch Robert Spaemann gehörten.
Ihre Philosophie der Bürgerlichkeit beschreitet einen eigenständigen ideengeschichtlichen Weg und liberalisiert die konservativ-antidemokratischen Vorstellungen eines Carl Schmitt und Arnold Gehlen. Jens Hacke rekonstruiert diese politische Philosophie, deren Grundlinien sich in der Aufarbeitung schwieriger deutscher Traditionen, aber auch in Auseinandersetzung mit der kritischen Gesellschaftstheorie eines Jürgen Habermas ausgeformt haben.
Ihre Philosophie der Bürgerlichkeit beschreitet einen eigenständigen ideengeschichtlichen Weg und liberalisiert die konservativ-antidemokratischen Vorstellungen eines Carl Schmitt und Arnold Gehlen. Jens Hacke rekonstruiert diese politische Philosophie, deren Grundlinien sich in der Aufarbeitung schwieriger deutscher Traditionen, aber auch in Auseinandersetzung mit der kritischen Gesellschaftstheorie eines Jürgen Habermas ausgeformt haben.