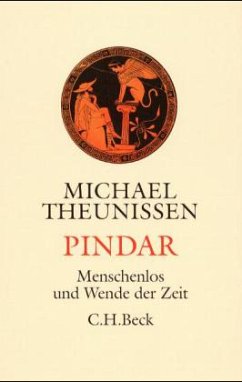Michael Theunissen führt den Leser durch zweihundertfünfzig Jahre griechischer Geistesgeschichte und macht ihn zugleich vertraut mit Grundbegriffen der griechischen Philosophie. Dabei unternimmt er erstmalig den Versuch, vor diesem gewaltigen Epochenhintergrund das dichterische Werk Pindars, das seinen Ausgangs- und Bezugspunkt bildet, philosophisch zu interpretieren.
Fixpunkte dieser fesselnden tour d´horizon durch jene literarischen Zeugnisse, die während 250 Jahren entstanden und unverbrüchliche Bestandteile unseres kulturellen Gedächtnisses geworden sind, bilden die Oden Pindars. Von ihnen ausgehend und auf sie hin werden Epos und lyrische Poesie auf ihre Aussagen über Glück und Unheil, Ausgeliefertsein und Geborgensein, über Glanz und Elend des Menschen befragt. Deutlich wird, daß der Mensch letztlich ein Spielball der Götter ist und sich nur behutsam tastend einer ihm verhängten Zukunft nähern kann. Deutlich wird aber auch, daß der verantwortungsvoll handelnde MenschMöglichkeiten erlangt, über sein Los und seine zeitliche Gebundenheit hinauszuwachsen, wenn er sich vor den Gefahren der Hybris hütet, sich die Scheu vor den Göttern bewahrt und sein Leben mutig und selbstbewußt gestaltet. Wie dieses Übersteigen der eigenen Grenzen aussehen mag, zeichnet der Autor in einfühlsamer sprachlicher Differenziertheit nach. Dafür, daß die Lektüre dieses Buches ein echtes intellektuelles Abenteuer wird und nicht auf der Stufe beliebiger Anmutung verharrt, garantieren scharf konturierte, gut nachvollziehbare Erklärungen zentraler Begriffe wie Hoffnung, Glück und Schicksal, aber natürlich auch all jener Wörter, die den Zeitbezug des menschlichen Daseins beschreiben.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Fixpunkte dieser fesselnden tour d´horizon durch jene literarischen Zeugnisse, die während 250 Jahren entstanden und unverbrüchliche Bestandteile unseres kulturellen Gedächtnisses geworden sind, bilden die Oden Pindars. Von ihnen ausgehend und auf sie hin werden Epos und lyrische Poesie auf ihre Aussagen über Glück und Unheil, Ausgeliefertsein und Geborgensein, über Glanz und Elend des Menschen befragt. Deutlich wird, daß der Mensch letztlich ein Spielball der Götter ist und sich nur behutsam tastend einer ihm verhängten Zukunft nähern kann. Deutlich wird aber auch, daß der verantwortungsvoll handelnde MenschMöglichkeiten erlangt, über sein Los und seine zeitliche Gebundenheit hinauszuwachsen, wenn er sich vor den Gefahren der Hybris hütet, sich die Scheu vor den Göttern bewahrt und sein Leben mutig und selbstbewußt gestaltet. Wie dieses Übersteigen der eigenen Grenzen aussehen mag, zeichnet der Autor in einfühlsamer sprachlicher Differenziertheit nach. Dafür, daß die Lektüre dieses Buches ein echtes intellektuelles Abenteuer wird und nicht auf der Stufe beliebiger Anmutung verharrt, garantieren scharf konturierte, gut nachvollziehbare Erklärungen zentraler Begriffe wie Hoffnung, Glück und Schicksal, aber natürlich auch all jener Wörter, die den Zeitbezug des menschlichen Daseins beschreiben.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Im Kairos schimmert die Fülle der Zeit: Michael Theunissens beeindruckende Pindar-Studie / Von Thomas Poiss
Die eine Hälfte magst du atmen unter der Erde, / die andere in des Himmels goldenen Häusern", so lautet die Bedingung, die Zeus seinem unsterblichen Sohn Polydeukes stellt, als dieser um das Leben seines toten Zwillings Kastor fleht. Polydeukes verzichtet, ohne zu zögern, auf seinen Anteil Himmel, gibt dem Bruder Augenlicht und Stimme zurück und teilt mit ihm nach freier Wahl das Leben zwischen Himmel und Hades. In solchen Mythen deutete der griechische Lyriker Pindar vor 2 500 Jahren die condition humaine auf eine Weise, die noch heute trifft. Dies zeigt auch die Lektüre des Pindar-Buches von Michael Theunissen. Der Philosoph, mit dessen Büchern über Sozialontologie, Hegel und Kierkegaard Generationen deutscher Philosophiestudenten aufgewachsen sind, hat in fünfzehnjähriger Arbeit das beste Werk verfaßt, das je über Pindar geschrieben worden ist, das zuweilen aber auch unvermittelt ins Bodenlose stürzen läßt.
Dies liegt in der Unfaßbarkeit des Gegenstandes, denn Theunissens Thema ist die Zeit. Zeit meint jene inhaltlich nicht bestimmbare Macht, deren Wirklichkeit wir als Herrschaft erfahren, die wir punktuell auf ein "Anderes der Zeit" hin transzendieren können, von dem aus wir uns wieder - sei es resignativ, sei es in positiver Inversion - in die Zeit zu wenden haben. Diese Struktur bedingt zweierlei: Zeit im Singular wird primär durch das Kriterium ihrer Negativität, ihrer Herrschaft über uns bestimmt und bildet somit jene Form, in der unser nachmetaphysisches Zeitalter Transzendenz erfährt. Aufschluß über sie können wir am ehesten auf dem Umweg über die frühe griechische Dichtung gewinnen, denn: "Die Zeitbegriffe bei Pindar umfassen den Inhalt des Geschehens in der Zeit mit." Diese fehlende Abstraktheit ist für Theunissen der entscheidende Vorzug des frühgriechischen Zeitbegriffs auch um den Preis, nur von Zeiten im Plural, untrennbar von ihrem jeweiligen Prozeß, sprechen zu können. Pindar, so Theunissens These, habe die transzendierbare Herrschaftsstruktur von Zeit und die darin liegende Einheit der Zeit erkannt - und diese zum Prinzip seiner Dichtung gemacht.
Daraus folgt die unübersichtliche Textur des Buches, die auf einzelnen Stellen basierende Begriffsgeschichte mit der Interpretation von Gedichten verknüpfen muß, um die darin gestalteten Zeitstrukturen freilegen zu können. Dieser materialfreundliche Zugriff unterscheidet Theunissen von Heideggers analogem Versuch, mit den frühen Griechen Sein von Zeit her zu denken, und so ist eher Hermann Fränkels Aufsatz über den frühgriechischen Zeitbegriff (1931) als Katalysator für Theunissens Denken anzusehen. Fränkel hatte dargestellt, wie aus der leeren, nspezifischen Dauer der homerischen Zeit, chronos, bis zu Pindar eine aus der Zukunft herankommende, aktive Macht Chronos wird, die auch all jene Potenzen absorbiert, die bei Homer noch unter dem Begriff Tag subsumiert wurden. Der Tag war es, der bis weit in die Epoche der Lyrik hinein menschliches Handeln und Denken beherrschte, ehe Solon zum ersten Mal die Zeit zum Agens machte.
Theunissen revidiert diesen Ansatz und gewinnt daraus den Aufbau seines Buches: In einem ersten Durchgang wird die Geschichte der schicksalhaften Tagzeit nachgezeichnet, die durch das Plötzliche, exaiphnes, das Hereinbrechen einer göttlichen Macht, transzendiert werden kann; im zweiten Gang wird Pindars Chronos-Zeit dargestellt, deren Herrschaft im kairos, der Maßgabe des Augenblicks, aufgehoben wird. Bemerkungen zu Heidegger und Hölderlin beschließen den Band. Theunissens Ausarbeitung der Tagzeit ist ebenso klar im Großen wie vertrackt im Kleinen. Stelle um Stelle wird auf ihre Struktur hin befragt und in eine teleologische Entwicklung eingeordnet, die vom Tag zur geschichtlichen Zeit führt. Über fast jede Stelle könnte man diskutieren; besonders heikel scheint das Sappho-Kapitel, auch das Entwicklungskonzept selbst ist nicht unproblematisch. Aufgewogen wird dies durch die Systematik, mit der die Zeitbegriffe nuanciert, um hora und aion ergänzt und mit elpis (Hoffnung/Erwartung), Schicksal und Gottesbegriff zusammengesehen werden. Die Trennschärfe von Theunissens Intellekt bewährt sich in der abschließenden Interpretation der Zwölften Pythie: Von unscheinbaren Sentenzen über Schicksal und Zeit fällt Licht auf das Gedicht als reflexiven temporalen Transformationsprozeß, der im Lied auf einen Flötenspieler das Entstehen der Kunst aus äußerstem Leid begründet.
Der zweite Hauptteil gilt der Chronos-Konzeption Pindars, die in der Aussage gipfelt, Chronos sei "der Vater von allen". Theunissen expliziert diese Allmacht in der Interpretation zweier Gedichte, die Zeit auf unterschiedliche Weise darstellen und durchbrechen: Die Zehnte Olympie zeigt, wie beschämende Verspätung und triumphale Erfüllung zusammenspielen, die Zweite Olympie wendet die Unumkehrbarkeit begangener Schuld ins Positive. Dies geschieht im kairos, in dem Zusammenspiel von Situation und Augenmaß, das die Herrschaft der Zeit durch aktive, fast anschmiegsame Teilhabe an ihr unterläuft. In der Strukturanalyse der Kairos-Stellen erreicht Theunissens Interpretation die Intensität von Kunst. Seine Lesart umgreift griechische Partikelsyntax ebenso wie Adornos Reflexion über den "Zeitkern der Wahrheit", und gleichsam in sprachlicher Zeitlupe können wir mit ansehen, wie Pindar die Synergie menschlichen Handelns mit unverfügbar Hereinbrechendem gelingen läßt.
Für Momente meinen wir, der Arbeit der Zeit im Werk des Dichters zusehen zu können: "Die Dichtung Pindars unterwirft sich dem Gesetz eines Kairos, der die Kairos-Struktur der Wirklichkeit widerspiegelt." Läßt man die heikle Spiegelmetapher auf sich beruhen - sieht nicht in der Ersten Pythie eher die Wirklichkeit der Kunst ähnlich als umgekehrt? - und nimmt man mit Theunissen diesen Kairos als Maßgabe jedes Sprechens und Handelns ernst, wird man sowohl bei Pindar als auch über Literatur hinaus prozessuale Strukturen entdecken, die seine Gültigkeit bestätigen. Kairos wird so aber auch zum Prinzip jener Kritik, die für Theunissens brillantes Buch gilt. Wird dieses Kriterium in der Einzelinterpretation immer streng genug angewendet? Etwa wenn Theunissen fünf Seiten lang die Frage erörtert, ob ano kato "hinauf und hinab" oder "hin und her" bedeute? Das ist im Griechischen nicht so trivial, wie es klingt, doch hätte nicht auch eine Fußnote genügt? Der Kairos spricht auch gegen den sprachlichen Überschwang, der Theunissens maßvolle Diktion öfter erfaßt. Schlichtheit käme der für das Buch zentralen Interpretation der Zehnten Olympie zugute. Ein einfaches Gleichnis von Welle und Kiesel führt zu Auslegungen, doch fünfzig Seiten später wird mit einer Deutung argumentiert, die in diesen Auslegungen nicht begründet worden ist: Die Welle bezeichne Pindars Lied, das den "im wirbelnden Kiesel veranschaulichten Vorwurf hinwegspüle". Das ist richtig, wie Duktus, Kontext und Vergleich der Stelle zeigen: Warum so kompliziert? Auch der wohlwollendste Leser übersieht dabei fast, daß Pindar in diesem Gedicht jene Zeitstruktur gestaltet hat, die Theunissen ihm zuschreibt. Denn er kann zeigen, wie im Gedicht der zentrale Gedanke von Zeit, "die allein Wahrheit, wie sie wirklich ist, durch Prüfung ans Licht bringt", in Mythos, Sportsieg und Lied als homologes Wahrheitsgeschehen zur Darstellung kommt: Zeit bewegt Dichter und Sieger, Zeit erfüllt den Zeus-Sohn Herakles, ja, Zeit geht durch einen vor Theunissen unerklärten Wechsel des grammatischen Subjekts in Herakles über, der so zum Verwirklicher von Zeit wird: Er lebt Zeit, erfüllt und übersteigt sie durch Gründung der Olympischen Spiele, das heißt, er vollzieht jene individuelle Zeitwende, die im Zentrum des Buches steht.
Hat man dies eingesehen, drängt sich die Frage auf: Was sollen wir heute mit Herakles? Konsultiert man Theunissens Aufsatzsammlung "Negative Theologie der Zeit" (1991), findet man nicht nur die Ankündigung des Pindar-Buches unter dem Titel "Herrschaft der Zeit", sondern auch den Aufsatz "Melancholisches Leiden an der Herrschaft der Zeit": Theunissens Pindar ist aus seiner psychiatrisch fundierten Forschung zu Melancholie und Schizophrenie hervorgegangen. Vor diesem Hintergrund wird das Pindar-Buch zur Auseinandersetzung mit Fragen der Gegenwart. Der Aufsatz "Können wir in der Zeit glücklich sein?" bietet Theunissens Überblick über alternative Konzeptionen von Zeit und drei Lösungsansätze für Glück: Herrschaft über die Zeit durch instrumentelles Zeitmanagement, Freiheit von der Zeit in ästhetischem Verweilen und Mimesis an die Zeit. So gesehen, gibt sich Pindars Herakles ebenso evident wie zwanglos als Inkarnation dieser dritten Variante zu erkennen: Herakles lebt Zeit als seine Zeit.
Hinter dieser diagnostisch-therapeutischen Dimension des Buches scheinen noch theologische Konturen durch. Theunissens Pindar ist - beinahe - Christ. Und dies ganz offen, denn als Fluchtpunkt der Kairos-Deutung wird etwa Matthäus 1, 15 genannt: Im Kairos schimmert die "Fülle der Zeit". Auch wenn von Zeus und Herakles als "Gott und sein Sohn" gesprochen wird, sind die Konnotationen unüberhörbar. Die Pointe daran ist, daß Theunissen dies nicht gewaltsam hineinprojiziert wie Heidegger das Seine, sondern bloß akzentuierend hervorhebt, und das auch meist philologisch gestützt. Skepsis ist allerdings angebracht, wenn Theunissen im elpis-Kapitel erklärt: "Pindars Denken ist im Grunde und im ganzen Hoffnungsdenken." Das ist nur die halbe Wahrheit. Pindars Auftraggeber sind äginetische Sklavenhändler, sizilische Militärdiktatoren oder ein rhodischer Seriensieger, von dem es heißt: "Mit der Faust fand er sein Bestes." Mit diesen Herren teilt Pindar die im Sieg begründete Zuversicht, aber nicht unbedingt das, was unser Wort Hoffnung mitschwingen läßt.
Die christliche Orientierung, von Theunissen mit behutsam praktiziert, gewichtet auch die Nachbemerkungen. Theunissen teilt mit Heidegger den Impuls, Vorentscheidungen der abendländischen Tradition zu überprüfen; durch methodische Lauterkeit unterscheidet er sich aber wohltuend von jenem. Mit Hölderlin holt Theunissen seinen einzigen Vorläufer ein. Wie Hölderlins Versenkung in Pindar- und Sophokles-Lektüre jenen lodernden Punkt als "Wende der Zeit" verfolgt, der vom antiken Zeus zum "Gott der Zeit" in Hölderlins Tagen führt, so ermöglicht Theunissens negativistisches Strukturmodell der Zeit eine vergleichende Theorie der Zeiten von Pindars Glücksmomenten bis zur "Mimesis an die Zeit" als Befreiung aus Angst und melancholischem Zeitverlust. Theunissens Deutung von Hölderlins dichterischen und theoretischen Texten würde man gerne ausführlicher lesen, seine Interpretation von Hölderlins sogenannten Pindar-Fragmenten, kryptisch kommentierte Übersetzungen, mit denen der Band schließt, kann man nur atemberaubend nennen.
Wer sich auf Theunissens Text einläßt, gewinnt andere Begriffe und Erfahrungen von Zeit und von dem, was in ihr sich zeigt. Das Schreckliche an diesem wundervollen Buch ist die Mühe, mit der man seine Erkenntnisse aus steinigem Ballast hervorholen muß, aber so ist das Leben der Dioskuren, das uns Pindar und mit ihm Theunissen anbieten: halb Hades, halb Himmel. Wir sollten das Angebot annehmen.
Michael Theunissen: "Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit". C. H. Beck Verlag, München 2000. 1094 S., geb., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Um etwa tausend Seiten über einen griechischen Dichter zu schreiben, bedarf es mit Sicherheit der Überzeugung, dieser habe uns noch etwas zu sagen. Und es bedarf, wie Albert von Schirnding bewundernd anmerkt, eines Philologen und Philosophen "in Personalunion", um als Dolmetscher und Deuter dieser Dichtung zu fungieren. Von Schirnding hat sich von Theunissen auf die lange und abenteuerliche Zeitreise mitnehmen, ja mitreißen lassen. Theunissen habe sich auf das Thema Zeit konzentriert, berichtet von Schirnding, das als Vergänglichkeitsklage überpräsent war, aber ebenso konterkariert wurde von der Erfahrung der Transzendenz. Erstaunlich findet der Rezensent, dass es dem Autor gelungen ist, sich ohne Verkürzungen auf sein Thema einzulassen. Aber immerhin hat er ja auch 1094 Seiten dafür gebraucht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH