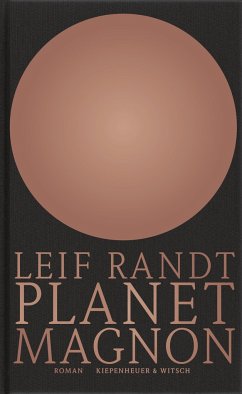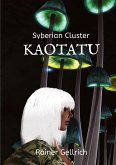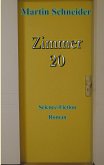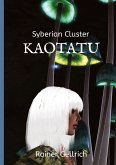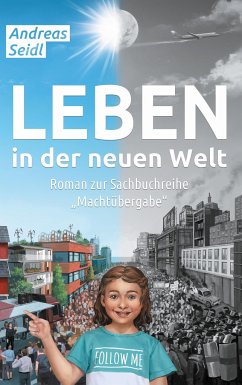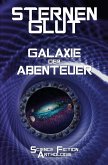Ein kühner, kunstvoller Gegenwartsroman aus einem anderen Sonnensystem
In den unendlichen Weiten des Weltraums existiert ein Sonnensystem, in dem endzeitlicher Frieden herrscht. Seine sechs Planeten und zwei Monde werden von einer weisen Computervernunft regiert, die auf Grundlage von perfekter Statistik und totalem Wohlstand die fairsten Entscheidungen trifft. Zwischen Metropolenplanet Blossom und Müllplanet Toadstool ist längst die neue Zeit angebrochen, eine postdemokratische Ära des Friedens und der Selbstkontrolle. Menschen haben sich zu Kollektiven zusammengeschlossen, zu ästhetischen Gemeinschaften, die um die besten Lebensstile konkurrieren. Marten Eliot und Emma Glendale, die beiden jungen Spitzenfellows des Dolfin-Kollektivs, verlassen ihren heimischen Campus und reisen von Planet zu Planet, um neue Mitglieder anzuwerben. Doch das Sonnensystem wird erschüttert, als das aggressive Kollektiv der gebrochenen Herzen von sich reden macht, von dem man annimmt, es bestehe aus emotionalen Verlierern. Minzefarbene Giftwolken steigen von Marktplätzen und Sommercamps auf, tatsächliche Gewalt droht in die Planetengemeinschaft zurückzukehren. Auf ihren Reisen rücken Marten und Emma die gebrochenen Herzen gefährlich nahe. Können die beiden den Umsturz verhindern? In »Planet Magnon« schickt Leif Randt seine Protagonisten in eine bizarr utopische Welt, in einen Kosmos der Saurier und Raumschiffe, der an neue Popmythen ebenso erinnert wie an Klassiker des Hollywoodkinos. Ihm gelingt die Vereinigung von poetischer Eleganz, literarischem Wagemut und packendem Genre.
In den unendlichen Weiten des Weltraums existiert ein Sonnensystem, in dem endzeitlicher Frieden herrscht. Seine sechs Planeten und zwei Monde werden von einer weisen Computervernunft regiert, die auf Grundlage von perfekter Statistik und totalem Wohlstand die fairsten Entscheidungen trifft. Zwischen Metropolenplanet Blossom und Müllplanet Toadstool ist längst die neue Zeit angebrochen, eine postdemokratische Ära des Friedens und der Selbstkontrolle. Menschen haben sich zu Kollektiven zusammengeschlossen, zu ästhetischen Gemeinschaften, die um die besten Lebensstile konkurrieren. Marten Eliot und Emma Glendale, die beiden jungen Spitzenfellows des Dolfin-Kollektivs, verlassen ihren heimischen Campus und reisen von Planet zu Planet, um neue Mitglieder anzuwerben. Doch das Sonnensystem wird erschüttert, als das aggressive Kollektiv der gebrochenen Herzen von sich reden macht, von dem man annimmt, es bestehe aus emotionalen Verlierern. Minzefarbene Giftwolken steigen von Marktplätzen und Sommercamps auf, tatsächliche Gewalt droht in die Planetengemeinschaft zurückzukehren. Auf ihren Reisen rücken Marten und Emma die gebrochenen Herzen gefährlich nahe. Können die beiden den Umsturz verhindern? In »Planet Magnon« schickt Leif Randt seine Protagonisten in eine bizarr utopische Welt, in einen Kosmos der Saurier und Raumschiffe, der an neue Popmythen ebenso erinnert wie an Klassiker des Hollywoodkinos. Ihm gelingt die Vereinigung von poetischer Eleganz, literarischem Wagemut und packendem Genre.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit "Planet Magnon" ist Leif Randts zweiter Roman erschienen, und Rezensentin Lena Bopp zeigt sich begeistert. Wenn auch nicht von der utopischen Welt, die der Autor hier entwirft, denn jene ist von Mitgefühl und Begeisterung befreit und stattdessen von Sachlichkeit und rationaler Durchdringung geprägt, berichtet die Kritikerin. Zugleich entdeckt Bopp in dieser auf verschiedenen Planeten spielenden Science-Fiction-Erzählung, die den Konflikt zwischen den "postpragmatischen" Dolfins und den Hanks, die in ihrer Ideologie zumindest Sympathie und Erkenntnis zulassen, durchaus vertraute Mechanismen - etwa den scheinbar freiwilligen Verzicht auf die eigene Freiheit. Insbesondere aber lobt die Rezensentin die brillante Konstruktion und die tiefgründige Komik dieses lesenswerten Romans.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ganz schön abgebrüht, diese Sachlichkeit: Leif Randt erkundet in seinem Roman "Planet Magnon" eine Galaxie, in der man Mitgefühl und Begeisterung einfach beseitigt hat.
Der wichtigste Satz fällt auf Seite 184. Marten, der Ich-Erzähler in dem Roman "Planet Magnon", ist gerade von einer Farm zurückgekommen, die er auskundschaften sollte. Nun berichtet er seiner Kameradin Emma, was er dort gesehen hat, und wie es ihm eigen ist, reflektiert er dabei seine Art des Kommunizierens gleich mit: "Ich spreche ruhig und fange nicht mit den entscheidenden Dingen an, sondern mit denen, die mich berührt haben."
Was so lapidar klingt und sich deswegen von dem Ton, den der 1983 geborene Leif Randt in seinem neuen Roman anschlägt, auch eigentlich nicht groß abhebt, birgt dennoch einen Schlüssel zu dessen Verständnis. Denn auf der Grundlage der einfachen Umkehr, die der zitierte Satz ausdrückt - Seit wann sind Dinge, die einen berühren, nicht mehr entscheidend? -, entwirft Randt eine utopische Welt, die, in eine Science-Fiction-Erzählung gekleidet, von einer Einstellung namens "Postpragmatismus" geprägt ist. Für das Kollektiv der "Dolfins", dem der Erzähler Marten angehört und das im Grunde nichts anderes als eine nach bestimmten Normen funktionierende Gesellschaft darstellt, der man bei ausreichender Befähigung beitreten kann, bezeichnet dieser Postpragmatismus eine Seinsweise, die nur dem Moment verhaftet ist, alles Geschehen rational durchdringt und Einflüssen anderer Kollektive offen gegenübersteht. Das Ideal der Dolfins besteht also darin, neben einer gewissen Sachlichkeit und Kontrolliertheit keiner bestimmten Idee zu folgen, oder anders ausgedrückt: einer Idee zu folgen, die ständig im Fluss ist.
Folgerichtig fühlen sich die Dolfins bedroht, als in dem Planetensystem, in dem sie leben, ein neues Kollektiv zu entstehen droht, das nicht nur an eine bestimmte Idee glaubt. Sondern dessen Idee sich auch noch auf einen Zustand bezieht, den die Dolfins quasi als präpragmatisch begreifen müssen - gemeint ist damit, natürlich, die Liebe. Denn die sogenannten Hanks, deren Adepten sich auf der genannten Farm versammeln, glauben an das Recht der "gebrochenen Herzen". Sie glauben, dass ein sachliches, vom Schmerz befreites Universum eine Illusion ist und dass man den Menschen das "Bewusstsein für das eigene Unglück" zurückgeben müsse. Nicht, dass die Menschen dadurch automatisch glücklicher würden. Aber - und dies ist eine weitere von den vielen hübsch verschnörkelten Ideen, aus denen Leif Randt seine schöne neue Welt zusammensetzt - die Hanks versprechen ihnen zumindest "Restchancen auf halbes Glück", will sagen: "Sympathie. Anerkennung. Diskurs. Erkenntnis".
Das Ganze ist weniger kompliziert, als es klingt. Denn wenn man diese, am Ende des Buches auch in einem langen Glossar eigens aufgedröselte Begrifflichkeit um Kollektive und ihren Pragmatismus einmal beiseiteschiebt, stößt man in dem Roman von Leif Randt schnell auf einen Kern, der jedem Leser vertraut sein dürfte, weil seine Bedeutung noch nie an eine bestimmte Zeit gebunden war, also auch nicht an die Zukunft. Es stimmt zwar, Leif Randt betreibt einen beachtlichen Aufwand, um seiner Geschichte den Anschein des Zukunftsträchtigen zu verleihen: Seine Kapitel heißen nicht Kapitel, sondern Episoden und sind in Unterkapitel gegliedert, welche die Namen der Planeten tragen, auf denen sie spielen. Sein Universum ist ein von politischen und gesellschaftlichen Debatten weitgehend befreiter Raum, in dem eine künstliche Intelligenz die Macht übernommen hat, wobei sie mit Hilfe statistischer Daten für eine Gerechtigkeit sorgt, die von (fast) allen auch als solche anerkannt wird. Es gibt Planeten, auf denen der Müll entsorgt wird, und Versorgungssicherheit für alle und jeden.
Aber im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen den Dolfins und den Hanks geht es eben um die Frage, ob das Wohlergehen, das als oberstes Gebot in diesen Sphären herrscht, nicht einen gewissen Preis hat. Ob all die Kollektive, die eine "schmerzlose Welt versprechen", nicht verlogen sind, weil sie den Menschen mit der Entscheidung über ihr Befinden auch die Hoheit über ihre Geschichte abnehmen? Ob das Recht, sich schlecht zu fühlen, nicht ein schützenswertes Gut sein könnte? Ob Unberührbarkeit überhaupt ein Ziel ist, das anzustreben sich lohnt? Mit diesen Fragen zeigt Leif Randt dem Leser die überspitzte Form eines Konfliktes, in dem es um die Freiheit und ihre Risiken geht. In seinem Roman entwirft er eine offene Gesellschaft, die sich (nur scheinbar paradoxerweise) freiwillig schon gegen diese Freiheit entschieden hat - und die deswegen nicht nur postpragmatisch, sondern eigentlich auch postdemokratisch ist.
In gewisser Weise schreibt Randt somit ein Thema fort, von dem schon sein erster, vor ein paar Jahren erschienener Roman "Schimmernder Dunst über Coby County" (F.A.Z. vom 6. August 2011) handelte. Schon darin geht es um einen utopischen Ort, der - am Meer liegend, sonnenbeschienen und hübsch ausgestattet - seinen Bewohnern eine Art von Überfluss bescherte, der diese und allen voran den Protagonisten Wim zu einer Armut an Ideen und Idealen verführte. Der Unterschied ist nun, dass Wim in Coby County noch selbst entschied, sich für nichts begeistern und also auch durch nichts mehr erschüttern lassen zu wollen. Diese persönlich getroffene Wahl ist in Randts neuem Buch einer Institutionalisierung gewichen. Der Verzicht auf Empathie ist zum System geworden, die Coolness zum Programm. Und doch hat Leif Randt aus diesem Szenario kein apokalyptisches Werk über eine sich selbst zu Tode rationalisierende Welt gemacht. Denn davor bewahrt ihn eine feingeschliffene, ebenfalls schon in "Coby County" zu findende Ironie, die er, stellenweise großartig, in die von ihm sonst so geschätzte Lakonik einfließen lässt. Auffallend sind in diesem Sinn eine Reihe von Sätzen, die Randt gerne an den Beginn oder den Schluss seiner Episoden stellt, um zu beschreiben, was gerade nicht der Fall ist: "Sie rennt los, ich folge, wir stolpern nicht", heißt es da etwa. Oder: "Die Scheiben waren getönt. Sonnenbrillen brauchten wir nicht." Oder auch: "Beim Landeanflug auf Snoop ist mir nicht blümerant geworden. Ich sehe keinen Anlass zur Sorge." Dieses Stilmittel passt gut zu dem postpragmatischen Erzähler Marten, weil es Nichtigkeiten mit einer Bedeutung auflädt, die sie eigentlich nicht haben. Es hält gleichzeitig die Möglichkeit offen, das ganze System aus einer distanziert ironischen Perspektive zu betrachten und somit wie eine Seifenblase zum Platzen zu bringen.
"Es ist auf jeden Fall ziemlich dolfin, sich in einem Moment der experimentellen Entrückung sachlich auf den Boden zurückzuargumentieren", sagt Marten einmal zu seinen Schülern. "Und ebendiese vermeintliche Sachlichkeit dann feierlich überzubewerten." Als er später auf dem Campus seinen Schülern wiederbegegnet und hört, wie der eine zum anderen sagt, es sei auch ziemlich dolfin, "nicht groß nachzufragen", da freut er sich darüber, wie die von ihm gerade erst vorgenommene Adjektivierung des Namens "Dolfin" gleich in den Sprachschatz übergegangen ist. Und genau um diese gedankliche Schleife, die, obwohl sie aus einer fernen Galaxie kommt, in die Dimension einer vollends sterilen Privatheit vorzustoßen weiß, dreht sich der gesamte Roman. Er ist ein Trauerspiel, gewiss. Aber eines, das vorzüglich konstruiert und abgründig komisch ist.
LENA BOPP.
Leif Randt: "Planet Magnon". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2015. 302 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Im Vordergrund steht [...] wie klug [...] diese Geschichte ist. Und wie perfekt Randt die Sprache dafür einsetzt. [...] Planet Magnon steckt voller gescheiter und verrückter Einzelheiten.« Frankfurter Rundschau 20150515