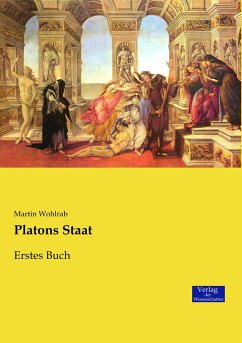Nach sechsjähriger Arbeit legt Badiou seine mutige Neuübersetzung von Platons 'Politeia' vor, in der sich philosophisches und literarisches Talent kongenial verbinden. In Badious 'Staat' sind Sprache und Denken der Akteure radikal modern und enthüllen so nicht nur eine neue Sicht auf ein jahrtausendealtes Werk, sondern schärfen den Blick auch für die brennenden Fragen unserer Gegenwart. Badiou wechselt zwischen wortgetreuer Übersetzung und freier Improvisation, unterteilt den Text in sechzehn statt in zehn Kapitel, modernisiert seine Bilder, erweitert seinen historischen Rahmen und durchsetzt ihn mit einem philosophischen Vokabular, das das unsere ist: Die Idee des Guten wird zur Idee des Wahren, die Seele zum Subjekt, Gott zum großen Anderen und Adeimantos zu Amantha, der ersten Frau in Platons Männerrunde.
Wer hier Verrat am Original schreit, hat zweifellos recht und übersieht doch, worum es Badiou hier wie überhaupt in seiner Philosophie eigentlich geht: Um eine Treue zu einem philosophischen Ereignis, das nicht ohne Folgen für unsere politische Aktualität bleiben darf, denn »letztlich ist es das, was die Ewigkeit eines Texts ausmacht«.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Wer hier Verrat am Original schreit, hat zweifellos recht und übersieht doch, worum es Badiou hier wie überhaupt in seiner Philosophie eigentlich geht: Um eine Treue zu einem philosophischen Ereignis, das nicht ohne Folgen für unsere politische Aktualität bleiben darf, denn »letztlich ist es das, was die Ewigkeit eines Texts ausmacht«.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Vernichtend liest sich, was Rezensent Christoph Horn - seines Zeichens Professor für antike Philosophie an der Uni Bonn - hier über Alain Badious Aktualisierung von Platons "Politeia" schreibt. Außer einem Lob für die deutsche Übersetzung begegnet er Badious Vorhaben mit tiefstem Unverständnis, und er macht auch klar, warum. Wieso, fragt er zum Beispiel, räumt Badiou aus Platos Dialogen all das weg, was uns heute fremd vorkommt, was wir eigentlich auch für die heutige Philosophie gar nicht "gebrauchen" können, jedenfalls nicht direkt, und bequemt sich aber andererseits, wenn auch oberflächlich (das Wort fällt!) dem platonischen Duktus an? Dabei sind die Dialoge bei Badiou dann auch wieder ganz anders aufgefasst: nicht langsam und systematisch und mit einbezogenen und selbstdenkenden Gesprächspartnern wie bei Plato, sondern selbstherrlich schwadronierend mit ergebenen Stichwortgebern. Horn zieht aus der Lektüre nicht nur keinen Erkenntnisgewinn - sie scheint ihm sogar unsympathisch zu sein.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Durch den Mund eines alten Philosophen und mit Ausblick auf eine wahrhaft kommunistische Gesellschaft: Alain Badiou findet in Platons "Staat" vor allem das, was er sich schon lange dachte.
Alain Badiou hat mit seiner im letzten Jahr erschienenen und bereits in mehrere Sprachen übersetzten "La République de Platon" eine Art Summe seiner Philosophie vorgelegt. Es ist ein irritierendes Buch, in dem Badiou Platon für sich sprechen lässt. Genauer: Es besteht aus einer meist paraphrasierenden Übertragung des Dialogs "Politeia" (Staat) von Platon ins Französische. Einige wenige Partien sind übergangen, häufiger und oft an zentralen Stellen ist der originale Text erweitert - um das, was Platon in Badious Augen hätte sagen müssen, wollte er als unser Zeitgenosse in gegenwärtige philosophische Diskussionen eingreifen können.
Badiou ist nämlich überzeugt, dass sich bei Plato universale, ja ewige Wahrheiten finden lassen, mit denen sich - in gehöriger Übertragung - verfestigte Positionen zeitgenössischer postmoderner Philosophie aufbrechen lassen und die darüber hinaus für die richtige Gestaltung des politisch-gesellschaftlichen Lebens in Anschlag zu bringen sind. Die Grundaussage, die Badiou aus dem platonischen "Staat" gewinnt, lässt sich knapp zusammenfassen: Die Meinung (doxa) bezieht sich auf das durch jeweilige historische Umstände fixierte Einzelne und dessen Strukturen, das Wissen (episteme) ist dagegen Ergebnis der Wahrheit, die sich dem reinen Denken "exponiert" - dieses "Exponierte" sind die platonischen Ideen. Es beziehe sich auf "die Universalität dessen, ..., was noch im Prozess seiner eigenen Variationen identisch bleibt". Das an das Einzelne gebundene Meinen gehöre zu dem "Tierischen" in uns und gilt Badiou als Ursache der "Individualinteressen" mit ihren Folgen Egoismus und Gier. Durch das "reine", von allem Individuellen abgelöste Denken dagegen werde aus dem "Individuum" ein "Subjekt", erreiche der Mensch einen Zustand des Unendlichen, Ewigen, Universalen und habe so an der (ihm möglichen) Unsterblichkeit teil.
Dieses unsterbliche Subjekt sei "die höchste Instanz" in uns, welche die "empfindliche, jähzornige, erregbare, instabile Instanz" ausschalten und auf das ausrichten kann, was für alle gleich gültig und gut ist. Diese Ausrichtung wiederum bildet die Voraussetzung einer "kommunistischen" politischen Gemeinschaft, die bei Badiou allerdings eher eine Mischung aus Rousseau und (indirekt rezipierter) Stoa ist. Aus ihr entsteht etwa die Forderung nach Bildung für alle ("ausnahmslos alle Kinder sollen ... so weit kommen zu studieren"), allerdings nicht durch "despotischen Unterricht", sondern dadurch, dass in ihnen "der schöpferische Funke" entzündet wird.
Die Nähe dieser Platon in den Mund gelegten Lehre zu Badious eigenen Positionen ist offensichtlich. Aber ein solches Verfahren kann nur dann mehr sein als die bloße Inanspruchnahme eines großen Namens, wenn der zugrunde gelegte Text tatsächlich als Fundament für die eigene Position taugt. Und man sollte eigentlich auch die Bereitschaft erwarten dürfen, sich mit dem Fremden und Abweichenden dieses immerhin zweieinhalbtausend Jahre alten Textes vertraut zu machen. Badiou aber folgt der Tendenz, das Fremde nur dort anzuerkennen, wo es "schon" dem Eigenen gleicht oder sich in es überführen lässt.
Das beginnt bereits bei der Begrifflichkeit. Etwa wenn Badiou "Seele" (psyché) mit "Subjekt" übersetzt oder "Gott" mit "der große Andere" oder auch einfach "der Andere". Gott ist für Platon identisch mit dem Einen (Hen), da alles nur dann irgendwie etwas sein kann, wenn es eine Form der Einheit aufweist. Für Badiou ist "der Andere" Ausdruck für ein Sein reiner Vielfältigkeiten, eine Mannigfaltigkeit von Mannigfaltigen, eine nichttranszendente Unendlichkeit.
Ein wichtiger Baustein für diese tiefgreifende Umdeutung ist Badious Auslegung des Verhältnisses von Meinung und Wissen. Für Platon ist das Seiende erkennbar, das Nichtseiende unerkennbar, das Meinen bezieht sich auf "mehr oder weniger Seiendes": Badiou übersetzt - wie viele seiner französischen Vorlagen - "sein" mit "existieren" und handelt sich damit viele Einwendungen ein: Es gibt schließlich auch von Nichtexistierendem sicheres Wissen, etwa vom Begriff des Dreiecks, und es ist kaum sinnvoll, von einer "Art Mitte zwischen der reinen Existenz und der absoluten Inexistenz" zu sprechen. Etwas existiert oder nicht, da gibt es keine Grade.
Platons Argumentation stützt sich dagegen auf die Erfahrung, dass alles, von dem man meint, dass es gerecht sei, auch ungerecht sein kann (es ist gerecht, Eigentum zurückzugeben, aber nicht dem Verbrecher das Mordwerkzeug), dass alles Schöne auch hässlich, alles Große auch klein sein kann und so fort. Woraus Platon den Schluss zieht, dass das, was man meint, immer nur mehr oder weniger genau etwas Bestimmtes (gerecht, schön, . . . ) ist. Es ist also ein "mehr oder weniger Seiendes" nicht, weil es mehr oder weniger existiert, sondern weil es nur etwas Bestimmtes, etwas "Distinktes" (wie man im Französischen gut sagen kann) ist. Etwas hat umso mehr (distinktes) Sein, je mehr es für sich selbst unterscheidbar ist.
Der Weg zu diesem Sein führt für Platon bevorzugt über die Mathematik. Badiou folgt ihm in diesem Punkt und macht einen aufschlussreichen Deutungsvorschlag. Er setzt Platons erkenntniskritische Grundlegung der mathematischen Wissenschaften in Analogie zur Mengenlehre, wie sie von Cantor, Gödel und Cohen konzipiert worden war. Die Mengenlehre entwickelt keine operative Theorie möglicher Rechenkalküle, sondern versucht eine theoretische Begründung dieser Möglichkeiten. Sie tut dies an einfachen Beispielen, die man aus didaktischen Gründen sogar schon in der Elementarschule benutzen kann, um in das, was Mathematik leisten kann, einzuführen. In vergleichbarer Weise sagt Platon (leicht ironisch), man müsse nur eins, zwei, drei richtig unterscheiden können, um sich jenes "Mathem" (erlernbare Wissen) methodisch zu erschließen, aus dem man die Kriterien für die Bestimmung distinkten Seins gewinnen könne. Auch hier ist Mathematik nicht als Theorie von Rechenoperationen benutzt, sondern als Theorie der Zahl. Auf diesen Aspekt - mit dem Platon die Tradition des Zusammenhangs von Erkenntnistheorie und Mathematik begründete - lässt sich Badiou allerdings nicht ein. Für ihn kommt Platon über ein "primitives Wissen, dank dem man bis drei und sogar noch etwas weiter zählen kann" und etwas "elementare Geometrie des Dreiecks und des Kreises" nicht wesentlich hinaus. Er ergänzt ihn daher um Errungenschaften der neueren Mathematik, von den n-dimensionalen Räumen Riemanns bis zur algebraischen Topologie.
Mit dieser "Modernisierung" Platons handelt sich Badiou allerdings das Gegenteil dessen ein, was er eigentlich erreichen wollte. Für ihn sollte der Zeitgenosse Platon Zeuge dafür sein, dass man die Strukturen, in denen eine fehlgeleitete Rationalität die Vielfalt der Wirklichkeit verfestigt, durch die Erfahrung eines (immanent) Unendlichen aufbrechen könne. Platon also als Zeuge gegen eine Einheits- und Identitätsmetaphysik. Während aber die platonische Mathematik durch die Analyse möglicher Einheitsbedingungen eine elastische Offenheit für die Erfahrung und Beurteilung immer neuer Einheitsformen schafft, muss Badiou auf das hoffen, was er "Ereignis" nennt: den Einbruch des Unendlichen ins Endliche, durch den alles Bisherige außer Kraft gesetzt wird. Badiou hat dies nicht zufällig an der Weise erläutert, wie Saulus zu einem Paulus wird. Ein solches Denken ist rein, das heißt leer von allem Früheren, und führt zu einem "Wissen, das in der Lichtung jenes ewigen, sich dem reinen Denken exponierenden Teils des Seins gegründet ist." Einfacher gesagt: Die eigene Aktivität beschränkt sich auf die "Reinigung" des Denkens von allem Individuellen und Singulären, um dadurch offen zu werden für den Advent des sich von selbst zeigenden "Ewigen".
Selbst wenn man von der theologischen Überlastung dieser mindestens seit Giordano Bruno in vielen Varianten erprobten Denkfigur einmal absieht und auch davon, dass das Vertrauen, das "Sein" stelle sich dem "reinen Denken" selbst dar, ohne jede Begründung bleibt: Diese Denkfigur hat bei Badiou gerade nicht Offenheit stiftende Konsequenzen. Das "Subjekt" bleibt ja nur Subjekt, wenn es dem Sein treu bleibt. Das bedeutet bei Badiou auch, dass es das Individuum, das heißt das Tierische in sich, "deaktivieren" muss. Dieses Tierische muss letztlich unterdrückt und vernichtet werden. Nur das Universale und für alle Gute darf in einer Gemeinschaft, die Badiou dann "kommunistisch" nennt, erhalten bleiben. Auch in dieser Frage ist der "strenge" Platon elastischer und konzilianter. Er tadelt es, wenn Sinnlichkeit (epithymía) oder das Streben nach Anerkennung und Ehre (thymós) in uns allein den Ton angeben wollen. Aber sie haben ihre Funktion und eigenes Recht und werden durch die Vernunft optimiert, nicht unterdrückt.
Auch wenn man also mit Grund Gefallen daran findet, dass Badiou Platon systematisch ernst nimmt. Dieses Gefallen wäre erheblich größer, wenn er uns auch mit dem bei Platon Fremden vertraut gemacht hätte, statt es bloß rigoros in Eigenes zu übertragen.
ARBOGAST SCHMITT
Alain Badiou: "Platons ,Staat'".
Aus dem Französischen von Heinz Jatho. Diaphanes Verlag, Zürich-Berlin 2013. 400 S., br., 34,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Badiou hat mit hervorragendem Geschick die eigenen Kommentare in den Text Platons integriert. Damit ist sein Buch tatsächlich unklassifizierbar und einzigartig innerhalb seines Genres. Dies ist zugleich das Werk eines Schriftstellers.« Jean Ristat, Les lettres françaises