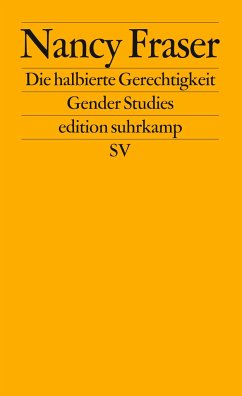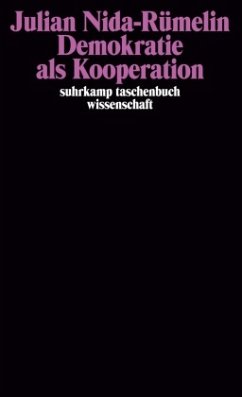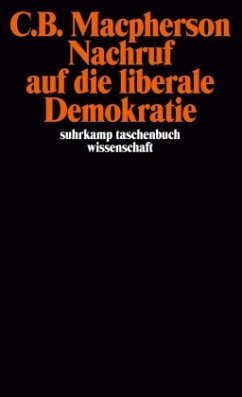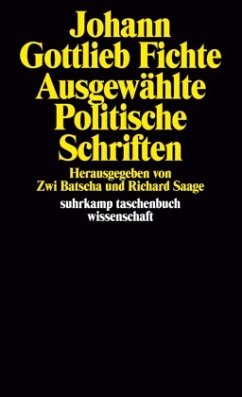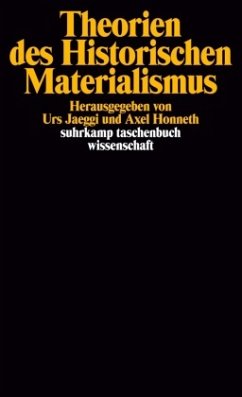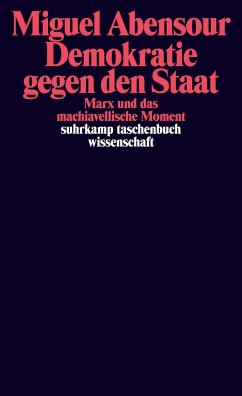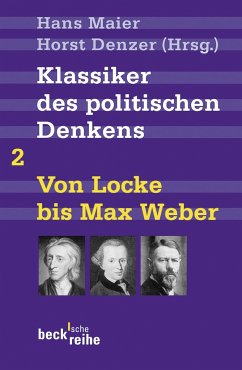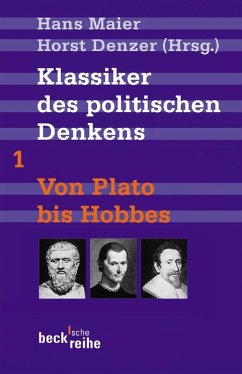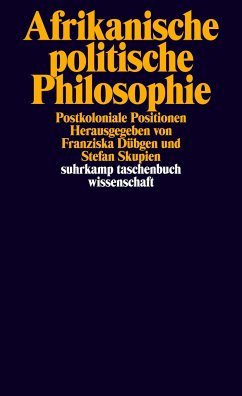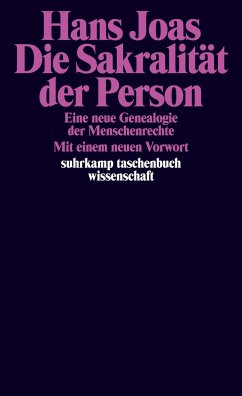Polis und Staat
Grundlinien der Politischen Philosophie
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Politik stellt eines der ältesten Themen der Philosophie dar. Die Sophisten und Platon haben es gewissermaßen erfunden, während der schulmäßige Aristotelismus die Politik bis an die Schwelle der Kantischen Denkrevolution begleitet hat. Allerdings war inzwischen mit der Konstruktion des neuzeitlichen Staates ein durchaus anderes Verständnis des Politischen aufgetreten, das unsere Auffassung heute bestimmt.Seit der Emanzipation der »Politischen Wissenschaft« als Spezialdisziplin im 20. Jahrhundert ist der Zusammenhang mit der Philosophie weitgehend zerbrochen. Das hat beiden Seiten nicht...
Politik stellt eines der ältesten Themen der Philosophie dar. Die Sophisten und Platon haben es gewissermaßen erfunden, während der schulmäßige Aristotelismus die Politik bis an die Schwelle der Kantischen Denkrevolution begleitet hat. Allerdings war inzwischen mit der Konstruktion des neuzeitlichen Staates ein durchaus anderes Verständnis des Politischen aufgetreten, das unsere Auffassung heute bestimmt.
Seit der Emanzipation der »Politischen Wissenschaft« als Spezialdisziplin im 20. Jahrhundert ist der Zusammenhang mit der Philosophie weitgehend zerbrochen. Das hat beiden Seiten nicht gutgetan, wie man inzwischen sieht. Deshalb wird in diesem Buch die Tradition des politischen Denkens von den Anfängen vergegenwärtigt. Fluchtpunkt bleibt aber die Gegenwart mit ihren systematischen Problemen, und also ergibt sich unter der Hand eine Auseinandersetzung mit der Politologie.
Seit der Emanzipation der »Politischen Wissenschaft« als Spezialdisziplin im 20. Jahrhundert ist der Zusammenhang mit der Philosophie weitgehend zerbrochen. Das hat beiden Seiten nicht gutgetan, wie man inzwischen sieht. Deshalb wird in diesem Buch die Tradition des politischen Denkens von den Anfängen vergegenwärtigt. Fluchtpunkt bleibt aber die Gegenwart mit ihren systematischen Problemen, und also ergibt sich unter der Hand eine Auseinandersetzung mit der Politologie.