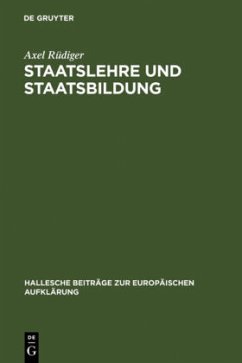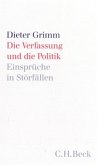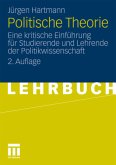Bibliothek des deutschen Staatsdenkens
Justus Möser (1720-1794) gehört zu den wichtigsten deutschen Staatsdenkern des 18. Jahrhunderts. Vor allem als Kritiker der egalitären Naturrechtslehre seiner Zeit und Fürsprecher der historisch gewachsenen politischen Rechte und Privilegien der Stände steht er am Übergang von der Aufklärung zum Historismus. Der juristische Praktiker, der im heimatlichen Fürstbistum Osnabrück zahlreiche öffentliche Ämter bekleidete, hat ein umfangreiches Oeuvre vorgelegt, aus dem der vorliegende Band eine Auswahl der wichtigsten Texte zum Staatsrecht trifft.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Justus Möser (1720-1794) gehört zu den wichtigsten deutschen Staatsdenkern des 18. Jahrhunderts. Vor allem als Kritiker der egalitären Naturrechtslehre seiner Zeit und Fürsprecher der historisch gewachsenen politischen Rechte und Privilegien der Stände steht er am Übergang von der Aufklärung zum Historismus. Der juristische Praktiker, der im heimatlichen Fürstbistum Osnabrück zahlreiche öffentliche Ämter bekleidete, hat ein umfangreiches Oeuvre vorgelegt, aus dem der vorliegende Band eine Auswahl der wichtigsten Texte zum Staatsrecht trifft.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Lohnende Wiederentdeckung eines deutschen Aufklärers: Justus Mösers patriotische Phantasien sind bis heute inspirierend
Der "Advocatus patriae" des kleinen Fürstbistums Osnabrück, Justus Möser (1720 bis 1794), war nicht nur in seinen Eigenheiten ein typisch deutscher Politiker und Intellektueller seiner Zeit, sondern auch eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Spätaufklärung, dessen geistige Wirkungen bis heute spürbar sind. Es ist daher zu begrüßen, wenn einige seiner wichtigsten Schriften in der verdienstvollen, von Hans Maier und Michael Stolleis begründeten und seit einigen Jahren gemeinsam herausgegebenen "Bibliothek des deutschen Staatsdenkens" aufs neue vorgelegt werden, ediert von dem wohl besten Möser-Kenner, dem Rechtshistoriker Karl H. L. Welker, dessen Studie "Rechtsgeschichte als Rechtspolitik" von 1996 mittlerweile das Standardwerk zum Verständnis des großen Osnabrückers geworden sein dürfte.
Wie wenige Autoren vor und nach ihm war Möser nicht nur, wie der Herausgeber anmerkt, "ein Staatsdenker, der aus der Praxis kam", sondern auch ein Autor, der - und zwar ausschließlich - für die Praxis schrieb, der seine Leser belehren, der als Schriftsteller und Publizist politisch wirken und auf diese Weise in die Wirklichkeit eingreifen wollte. Ob er für den englischen König (und hannoverschen Kurfürsten) Georg III. jene "Landtags-Propositionen" entwarf, die dieser den osnabrückischen Ständen zur Beratung vorlegte, ob er sein großes, unvollendet gebliebenes Geschichtswerk, die "Osnabrückische Geschichte", konzipierte oder ob er in den Intelligenzblättern - von der von ihm herausgegebenen "Deutschen Zuschauerin" bis hin zur berühmten "Berlinischen Monatsschrift" - publizierte: Nie ging es ihm um abstrakte, überzeitliche Erkenntnis, sondern stets und ausschließlich um die Realien und Realitäten der eigenen Gegenwart.
Möser war also alles andere als ein "philosophischer Kopf" (wie Schiller später sagen sollte), aber eben auch kein bloßer "Brotgelehrter". Seine Stärke bestand darin, aus dem harten Stein der Theorie Funken zu schlagen, um durch das so entfachte Feuer Nutzen zu ziehen. Beeindruckend bleibt in der Tat "sein Geschick, Politik und Recht zusammenzudenken", wie Welker betont: "Als ein an die Öffentlichkeit appellierender Jurist war er nicht nur seiner Zeit um Jahrzehnte voraus, sondern prägte mit seinem Anspruch, Gesetzgebung am Gemeinwohl zu messen, ein Berufsbild, das bis in die Gegenwart die Juristenausbildung bestimmt." Auch Mösers Geschichtsschreibung hatte politisch-praktischen Zwecken zu dienen. Die "Osnabrückische Geschichte" bot nicht nur politische Historiographie und Verfassungsgeschichte, sondern darüber hinaus, so Welker, ein "juristisches Arbeitsinstrument", da der Autor in vielen Textpassagen immer wieder eine Brücke zur Gegenwart schlug, und sogar eine Art "Nachschlagewerk", in dem sich die Bürger Osnabrücks über ihre Rechte informieren konnten.
Möser blieb zeitlebens auf den vergleichsweise kleinen Wirkungskreis seiner engeren Heimat beschränkt, die er nur selten verlassen hat. Seine wichtigste Auslandsreise führte ihn 1763/64 für sechs Monate nach London. Die hier empfangenen Eindrücke prägten ihn tief: Er war nach der Rückkehr nicht nur von seiner etwas naiven politischen Anglophilie geheilt, sondern er hatte ebenfalls den Unterschied zwischen "kleiner" und "großer" Politik verinnerlicht. Das britische Weltreich und das kleine deutsche Fürstbistum (es wurde seit 1648 abwechselnd von einem katholischen Bischof und vom Haus Braunschweig-Lüneburg regiert) sollten von nun an die beiden Größen und zugleich die Gegenpole seiner politischen Reflexionen bleiben.
Mösers Andacht zum Kleinen und zur Tradition, seine Vorliebe für das Alte, Einfache und Volkstümliche, nicht zuletzt seine Kritik der Französischen Revolution, deren Anfänge er noch miterlebte, haben ihm später das Etikett des "Urkonservativen" eingetragen. Welker kann klarmachen, daß dieses - an sich nicht falsche - Deutungsmotiv keineswegs überzogen werden darf, denn Möser habe, wie er sagt, "die historische Erfahrung nicht nur zur Rechtfertigung von Traditionen" genutzt, "sondern vor allem, um erstarrten Überzeugungen verbürgte Tatsachen entgegenzuhalten".
Die ausgewählten Texte belegen die Interpretation des Herausgebers. Ausdrücklich hat er Handschriften und Drucke zugrunde gelegt, "die bei bisherigen Editionen von Mösers Werken entweder unbeachtet blieben oder sprachlich überarbeitet wurden". Man hat hier sozusagen den "Ur-Möser" vor sich, den die erst vor wenigen Jahren abgeschlossene, seit 1943 erschienene (und in ihren editorischen Prinzipien nicht immer überzeugende) Gesamtausgabe vernachlässigt hat. Sogar Erstdrucke hat Welker zu bieten: Mösers für den britischen König entworfene Landtags-Propositionen für die Jahre 1765 bis 1767 werden hier wortgetreu (inklusive aller Streichungen) abgedruckt.
Diese Texte erlauben manchen Blick in Mösers Werkstatt: Sie zeigen die Realia, mit denen er es als Advokat und Syndikus der Stände fast täglich zu tun hatte, und sie verdeutlichen das sorgfältige Bemühen um den treffenden, möglichst präzisen Ausdruck. Schade, daß Welker auf erläuternde Anmerkungen verzichtet. Nicht jedem Leser, selbst wenn er einigermaßen mit der Aufklärungsepoche vertraut wäre, dürften Namen wie Clauer, Hegewisch, Strube oder Meiners auf Anhieb etwas sagen.
Der Band läßt etwas von jener Faszination erahnen, die vom Advocatus patriae einst ausgegangen ist - also von einem Historiker und Publizisten, der, wie Welker sagt, "eine Nationalgeschichtsschreibung ohne dynastische Orientierung forderte, in seinen ,Patriotischen Phantasien' ein Muster politisch-literarischer Bürgerbeteiligung schuf, der für das burleske Volkstheater eine Lanze brach und die Vitalität des Sturm und Drang befürwortete, der dem Anspruch Friedrichs des Großen, (sogar) die deutsche Sprache obrigkeitlich zu regeln, öffentlich entgegentrat".
HANS-CHRISTOF KRAUS
Justus Möser: "Politische und juristische Schriften". Hrsg. von Karl H. L. Welker. Bibliothek des deutschen Staatsdenkens. Hrsg. von Hans Maier und Michael Stolleis. Band 19. Verlag C. H. Beck, München 2001. 382 S., geb., 44,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als "lohnende Wiederentdeckung eines deutschen Aufklärers" begrüßt Rezensent Hans-Christoff Kraus den von Karl H. L. Welker herausgegebenen Band, der einige der wichtigsten politischen und juristischen Schriften von Justus Möser versammelt. Möser (1720-1794) war nicht nur ein typisch deutscher Politiker und Intellektueller seiner Zeit, erläutert Kraus, "sondern auch eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Spätaufklärung, dessen geistige Wirkungen bis heute spürbar sind". Als Staatsdenker, der aus der Praxis kam, schrieb Möser ausschließlich für die Praxis, berichtet Kraus, er wollte seine Leser belehren, als Schriftsteller und Publizist politisch wirken, und so in die politische Wirklichkeit eingreifen. Kraus stimmt mit dem Herausgeber Welker überein, der Mösers beeindruckendes Geschick, "Politik und Recht zusammenzudenken" hervorhebt. Den ausgewählten Texten hat Welker Handschriften und Drucke zugrunde gelegt, so dass man hier den "Ur-Möser" studieren und manchen Blick in Mösers Werkstatt werfen kann, freut sich Kraus. Insgesamt lasse der Band etwas von jener Faszination erahnen, die einst von Justus Möser ausgegangen ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH