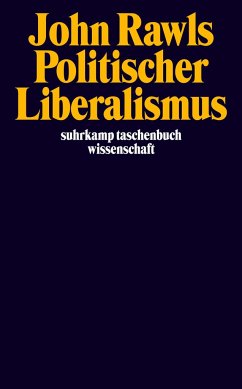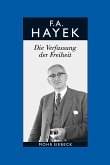In diesem Buch stellt John Rawls die in Eine Theorie der Gerechtigkeit entwickelte vertragstheoretische Auffassung von Gerechtigkeit als Fairneß in den weiteren Kontext einer allgemeinen Theorie politischer Legitimität und Gerechtigkeit. Dabei kommt es gegenüber der ursprünglichen Konzeption zu einer Reihe von Erweiterungen und Korrekturen. Sie betreffen insbesondere die Stabilität der Gerechtigkeit einer wohlgeordneten Gesellschaft. Ausgangspunkt des politischen Liberalismus ist die uneingeschränkte Anerkennung der Möglichkeit und des Faktums eines vernünftigen Pluralismus. Rawls zeigt die Begründbarkeit einer politischen Gerechtigkeitskonzeption in einer Gesellschaft, deren Mitglieder verschiedene und zum Teil entgegengesetzte religiöse und moralische Wertvorstellungen und Lebensauffassungen vertreten.

Was alle angeht, sollen alle verstehen: John Rawls findet die Gerechtigkeit in vorletzten Diskursen / Von Dirk Kaesler
Dieses Buch ist ein Heilmittel für alle diejenigen, denen die Monate des Wahlkampfes reichlich sauer geworden sind angesichts der plakatierten Nullaussagen und des sprachlichen Schwachsinns, mit denen die PR-Agenturen uns umsorgten. Es kann zudem jene trösten, deren Glaube an das Restvorkommen politischer Argumente ins Wanken geriet. Nach all dieser geistigen Zuckerwatte wirkt das gewichtige Buch wie nahrhaftes Vollkornbrot, das allerdings gründliches Kauen verlangt. Wer sich aber der Lesearbeit unterzieht, wird erheblichen Nutzen für die Eichung seiner politischen Urteilsfähigkeit ziehen.
In dieser philosophischen Kampfschrift für einen "Politischen Liberalismus" geht es John Rawls um die für liberale Demokratien zentrale Frage: Wie gelingt uns eine "wohlgeordnete Gesellschaft", eine gerechte Gesellschaft freier und gleicher Bürger? Wie kann es gelingen, eine solche Gesellschaft dauerhaft zu bilden, angesichts höchst unterschiedlicher Vorstellungen von Gerechtigkeit? Das politische Problem ist dabei nicht nur das der Uneinsichtigkeit oder Unwilligkeit der Gesellschaftsmitglieder, sondern die Tatsache, daß deren so unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit durch jeweils recht vernünftige religiöse, philosophische und moralische Lehren erzeugt und begründet werden, die sich häufig untereinander ausschließen. Es geht Rawls darum, die Möglichkeit eines übergreifenden politischen Konsenses angesichts dieser Pluralität verschiedener Lehren über Gerechtigkeit auszuloten, es geht, wie er das nennt, um einen "vernünftigen Pluralismus".
Hinter seinem Vorhaben steht das Wissen, daß moderne Gesellschaften in Gefahr stehen, an ihrem paradoxen Charakter zugrunde zu gehen. Eingespannt in das Streckbett zwischen Autonomiegewinn und Autonomieverlust, zwischen persönlicher Freiheit und disziplinierter Einordnung in die Gesellschaft, stellt sich für jedes Individuum die Frage nach den Chancen der Verwirklichung der Freiheit in einer gerechten Gesellschaftsordnung.
Spätestens seit der Aufklärung werden über diese Fragen zahlreiche Debatten geführt, an denen sich die jeweils einflußreichsten Denker beteiligten. Jede Zeit wird ihr eigenes Repertoire dieser Diskurse und der jeweiligen Positionen entwickeln. In den "postmodernen" Zirkeln, die sich Jean-François Lyotard anschließen, wird die Möglichkeit einer Lösung dieser Problemstellung prinzipiell verneint, aufgrund der unüberbrückbaren sprachlichen, kulturellen oder sozialen Gegensätze. Daneben haben sich jedoch in den letzten Jahren vor allem zwei ernst zu nehmende Ansätze herausgebildet, die konstruktive Lösungsmöglichkeiten entwerfen wollen. Zum einen der Kommunitarismus, vor allem soweit er Amitai Etzioni folgt, zum anderen die Diskursethik, wie sie mit dem Namen von Jürgen Habermas verbunden wird. In beiden Debatten geht es gleichermaßen um besagte Grundsatzfrage nach der Erzeugung und Bewahrung einer stabilen und integrierten Gesellschaft freier und gleicher Bürger angesichts divergenter Vorstellungen von Gerechtigkeit.
Dabei vertreten die Kommunitarier einen partikularistischen Ansatz, der überschaubaren Gruppen wie Nachbarschaftsverbänden oder Gemeinden mehr Eigenverantwortlichkeit bei ihrer jeweiligen Lösung der Probleme gesellschaftlichen Zusammenhangs einräumt. Ungeachtet der Anerkennung grundlegender Richtlinien für Menschen aller Kulturen bleibt bei ihnen die konkrete Ausgestaltung und Durchsetzung solcher Prinzipien der jeweiligen Gemeinschaft überlassen. Die Diskurstheoretiker hingegen vertreten einen universalistischen Ansatz, der die Erwartung und Hoffnung hegt, daß Menschen auf rationalem Weg über alle kulturellen, gesellschaftlichen und persönlichen Schranken hinweg eine konsensfähige Übereinstimmung erzielen können.
Rawls gehört dem Lager der Universalisten an. Er setzt sich jedoch von Habermas ab, wie er in seiner "Reply to Habermas", die in der amerikanischen Taschenbuchausgabe von 1996 enthalten ist, detailliert ausführte. Er will eine Gesellschaft herbeiführen, die als faires System sozialer Kooperation zwischen freien und gleichen Personen betrachtet wird. Doch im Gegensatz zu Habermas besteht der Emeritus der Harvard University darauf, daß es einen pragmatischen und nicht normativen Weg zur Erlangung einer solchen "wohlgeordneten Gesellschaft" gibt. Rawls arbeitet daran, eine moralneutrale Begründung eines politischen Konsenses über Gerechtigkeit als Fairneß zu liefern. Im Vergleich zum deutschen Sozialphilosophen Habermas ruft Rawls im Geist des amerikanischen Pragmatismus generell dazu auf, solche Erörterungen tiefer zu hängen und auf alle Letztbegründungsversuche zu verzichten. Bei aller pragmatischen Skepsis bezieht sich dabei jedoch auch der amerikanische Philosoph direkt auf jene Überzeugung, die Kant schon 1797 formulierte: "Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben."
Vor siebenundzwanzig Jahren legte Rawls seine epochale "Theorie der Gerechtigkeit" vor. In diesem mittlerweile klassischen Beitrag zur modernen Moral- und Rechtsphilosophie entfaltete er seine vertragstheoretische Auffassung von Gerechtigkeit als Fairneß. Nach zahlreichen Aufsätzen hat Rawls mit dem "Politischen Liberalismus", seinem zweiten Hauptwerk, seine Überlegungen in die Gestalt einer allgemeinen Theorie politischer Legitimität und Gerechtigkeit gegossen. Mit der behutsamen Übersetzung von Wilfried Hinsch, die passagenweise weitaus akademischer klingt als das amerikanische Original, das 1993 erschienen ist, kann nun auch die deutsche Leserschaft Rawls' Unternehmen nachvollziehen. Zum einen setzt Rawls sich beeindruckend selbstkritisch mit einer ganzen Armada seiner englischsprachigen Kritiker auseinander, indem er dankbar jene Argumente aufnimmt, die ihn überzeugt haben. Zum anderen ist es seine erklärte Absicht, eine Programmschrift eines "Politischen Liberalismus" auszuarbeiten, eine politische Gerechtigkeitskonzeption für konstitutionelle Demokratien. Beides ist ihm überzeugend und beeindruckend gelungen.
Es wäre diesem imposanten Einmannunternehmen gegenüber, für das sein Schöpfer drei Jahrzehnte seines Arbeitens investierte, vermessen, so zu tun, als ob man dessen Ergebnisse auf wenige Zeilen kondensieren könnte. Die überaus zupackende und klare Rede- und Schreibweise des Verfassers bürgt dafür, daß nur sehr wenig Redundanzen verbleiben. Jeder der Schritte in den acht aufeinander aufbauenden Vorlesungen beginnt dort, wo die vorhergehende Vorlesung endete. Jeder Paragraph innerhalb der Vorlesungen, die daher eher Lektionen sind, nimmt die Leser auf einem logisch nachvollziehbaren Weg durch die Entwicklung eines Arguments mit. Dabei spricht der Autor ganz direkt und persönlich mit seinem Leser, weist ihn, manchmal ein wenig schulmeisterlich, auf noch bestehende Unklarheiten hin, faßt den Stand der Argumentation zusammen, um anschließend mit ihm gemeinsam weiterzugehen. Das Buch ist ein überragendes Beispiel für die Mühen und die Erträge gedanklicher und begrifflicher Arbeit. Allein durch ebenso konzentrierte Lesearbeit kann man ihm gerecht werden.
Welchen Gewinn hat man, wenn man sich derart durch fünfhundert Seiten führen läßt? Ein anspruchvolles und geduldiges Gespräch mit einem klugen Mann, der sich seit seiner Dissertation an der Princeton University im Jahr 1950 fast ausschließlich mit dem Thema der Gerechtigkeit wissenschaftlich beschäftigt. Er ist ein Philosoph mit der festen Überzeugung, daß dieses Thema nicht nur ein abstrakt philosophisches ist, sondern sehr konkrete Bedeutung für die politische Gestaltung einer modernen Gesellschaft hat. Der seinen Lesern Hoffnung und Vertrauen auf die Chancen der menschlichen Vernunft vermittelt. Der sein Publikum gleichzeitig in Resignation und Spott treiben kann, wenn es erkennt, daß der Blick in die Zeitung oder die Nachrichtensendung deutlich macht, daß die menschliche Vernunft in Tagespolitik und banaler Alltagserfahrung oft eine recht bedrängte Rolle innehat.
Das Bild, das Rawls uns von einer fairen Gesellschaft malt, muß jeden Gutwilligen erfreuen. Zugleich kann es jeden betrüben, der es als Maßstab an real existierende Gesellschaften anlegt. Hat man jedoch erkannt, daß es keine Beschreibung konkreter Gesellschaften ist, sondern das (Wunsch-)Bild ersehnter, aber auch möglicher Gesellschaften, verliert sich das permanente innere Kopfschütteln: Wo lebt dieser Mensch eigentlich? Erst wenn man versteht, daß Rawls die Idealvorstellung eines demokratischen Verfassungsstaates ausarbeitet, kann man seine Aussagen richtig einordnen, in denen er unmißverständlich die gesellschaftlichen Voraussetzungen benennt, die es erst ermöglichen, die allgemeine Vernunft öffentlich werden zu lassen: so etwa die Garantie der Zugänglichkeit von politisch relevanten Informationen, die Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung und eine "sittlich akzeptable Einkommens- und Vermögensteilung". Allen Bürgern, so Rawls, müssen die notwendigen, allgemein dienlichen Mittel garantiert werden, damit sie auf wirksame Weise von ihren Grundfreiheiten Gebrauch machen können, damit sie ihre Selbstachtung als Bürger überhaupt erst erlangen können.
Das fulminante Werk des Siebenundsiebzigjährigen ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den common sense, die menschliche Vernunft, den Mut zum öffentlichen Vernunftgebrauch, auch und gerade in der Politik. Die Bundeszentrale für Politische Bildung sollte jedem der neuen und alten Abgeordneten zum Deutschen Bundestag ein Exemplar auf den soeben erkämpften Platz im Parlament legen. Und wir als Zuschauer des Spektakels Politik sollten dieses Buch dazu nutzen, unermüdlich danach zu fragen, was das, was uns dort vorgeführt wird, mit der Herstellung, Bewahrung und Erweiterung von Gerechtigkeit in dieser konkreten Gesellschaft zu tun hat. Und wir sollten versuchen, dies ebenso in der nüchternen, pragmatischen Art des John Rawls zu tun, ohne jedes Pathos und Wertgeraune. Es geht ihm weder um "Wahrheit" noch um eine umfassende moralische Lehre, sondern um eine konstruktive Konzeption von Vernünftigkeit und Fairneß, um einen Beitrag zur Erziehung der Staatsbürger zu eigener Urteilsfähigkeit. Da der Gerechtigkkeitssinn und die Fähigkeit zum Nachdenken über das Gute ihnen in die Wiege gelegt wurden, spüren die Menschen sehr genau, was fair ist. Rawls sagt uns, daß es auch gerecht ist.
John Rawls: "Politischer Liberalismus". Aus dem Amerikanischen von Wilfried Hinsch. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998. 539 S., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main