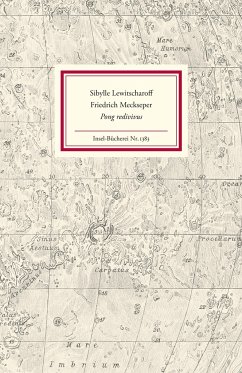Pong lebt! Mit schallendem Juchhe hat sich am Ende von Sibylle Lewitscharoffs Erzählung »Pong« der liebenswerte, verrückte Held dem Mond in die Arme geworfen - und hat, entgegen den Befürchtungen der Leser, diesen kühnen Sprung vom Dach überstanden. Nun liegt er im Krankenhaus und hat alle Zeit der Welt, sich seinen Gedanken hinzugeben, die vor allem um rätselhafte Objekte kreisen, die er zu Hause verwahrt. Durch »Pong«, 1998 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, wurde die literarische Öffentlichkeit auf Sibylle Lewitscharoff aufmerksam. Mit »Pong redivivus« haben Sibylle Lewitscharoff und Friedrich Meckseper ein sprach- und bildmächtiges Gesamtkunstwerk der magischen Art erschaffen.

Sibylle Lewitscharoffs Held Pong kehrt zurück
Die dunkelste Nacht wird hell, wenn man dieses schöne Insel-Büchlein liest: weil man einen misanthropischen Miesepeter mitten in einer Seelenwandlung ertappt. Weil man einen misogynen Meckerfritzen plötzlich bereit sieht, sich von einer Frau mit einer Kanarienvogelfeder an der Nase kitzeln zu lassen und dabei das reine Glück zu empfinden. Wer ist dieser Mann?
Die Rede ist von Pong, also jener Kopfgeburt, die Sibylle Lewitscharoff 1998 den Bachmannpreis einbrachte und sich in einem famosen Kurzroman austobte, bei dem man nicht erst am Ende, sondern fortwährend um die Existenz der Hauptfigur bangen musste. Denn dieser sonderbare Herr Pong ist nicht nur ein schwärmerischer Mondverehrer in der Tradition großer Romantiker, sondern auch ein rechter Lunatic, eine bipolare Kippfigur, einer, der auf dem Dach steht und noch mal kurz ums Haus fliegen will.
Wie wir nun erfahren, stürzt er aber nicht ab, sondern landet einigermaßen weich, erst im Geäst einer Blutbuche und dann mit gebrochenem Bein im Krankenhaus. Das ist die Gelegenheit für den Einbruch des Spülbecken-Realismus in die Erzählung: Als Kontrast zu Pongs poetischen und neurotischen Gedankenketten sieht man nun sehr plastisch ein deutsches Krankenhaus mit Kartoffelpüree und Labbertee, mit Pflegerinnen namens Mandy und Erika, türkischen Putzfrauen und gnadenlosen Weißkitteln, denen Pong zunächst mit Verachtung begegnet.
Der Leser wird jedoch bald merken, dass Pong, sobald ihm jemand etwas Gutes tut, und sei es nur die kleinste Geste, dies mit fast grotesker Dankbarkeit aufnimmt: Schon wähnt er den eben noch als Feind angesehenen Menschen als besten Freund. Besonders lustig und besonders rührend ist dieser Pong-Prozess zu beobachten, als überraschend ein Mann zu ihm ins Zimmer gelegt wird: "Das Allerschlimmste trat ein", heißt es da zunächst. Aber Pongs anfängliches Misstrauen schwindet, je mehr sich der Leidensgenosse als Interessenverwandter herausstellt: Beide lieben zum Beispiel die Fernsehserie "Monk", und bald sieht man sie gemeinsam davor giggeln.
Dass diese Erzählung wie aus einem Guss wirkt, ist umso erstaunlicher, als sie eine Art Fingerübung darstellt: Die Autorin hat sie nach eigener Auskunft "um einige Objekte herumgeschrieben" - nämlich solche, die ihr Ehemann, der Künstler Friedrich Meckseper, aus Pergament und Zinkblech, manchmal auch aus Algen und Kompassnadeln collagiert hat. Herausgekommen ist ein trotz aller kunstvollen Übertreibung realistisches Dokument des Wahns, das manchmal gar nicht so leicht zu ertragen ist, wie es durch seinen Esprit und Witz zunächst wirkt.
In ihrer Büchnerpreisrede hat Sibylle Lewitscharoff jüngst gesagt, die Verrückten auf dem Papier seien ihr lieber als die im wirklichen Leben. Das ist in ihrem Fall nicht bloß ein bequemer Spruch, sondern eine durch persönliche Erfahrung gewonnene Wahrheit. Im Bezug auf Pong hat die Autorin recht: Begegnen möchte man ihm eigentlich nicht. Über ihn lesen dafür umso lieber: von seinem Größenwahn und seiner skurrilen Soziophobie, von seinem unbedingten Willen zur Poetisierung der Welt - und von seinen sehr eigenen Überzeugungen wie etwa jener, das Mare humorum auf dem Mond sei ein feines Lächeln des Universums als Kommentar zu seinen Gedanken - "keineswegs, um ihn kleinzulachen, sondern nur, um ihm zu bedeuten, dass er alles, was auf der Erde geschah, vielleicht ein bißchen zu schwer nahm".
Wir plädieren nachdrücklich dafür, dass die aus Pongs Wesensart abgeleiteten Neologismen - also "Pöngeleien" für seine absurden Einfälle, "pöngeln" als deren gezieltes Herbeiführen - in den Duden aufgenommen werden. Pong steht im Regal vielleicht nahe bei Nabokovs "Pnin" (so wie der sein Zimmer pninisiert, wird auch das Krankenzimmer selbstverständlich zu einem Pong-Zimmer); er reiht sich aber auch gut irgendwo zwischen Büchners Lenz und Woody Allens Filmfiguren ein.
Vielleicht war es ja noch nicht das letzte Mal, dass man von diesem herrlichen Flattergeist gelesen hat. Das Ende des Buches ist dann nämlich wieder dramatisch genug, um auf eine weitere Fortsetzung zu hoffen, die den großen Betrübten wieder himmelhoch jauchzen lassen wird.
JAN WIELE
Sibylle Lewitscharoff, Friedrich Meckseper: "Pong redivivus".
Insel Verlag, Berlin 2013. 108 S., 14 farbige Abb., geb., 13,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Jan Wiele hofft schon jetzt auf eine Fortsetzung der "Pöngeleien" dieser dem Rezensenten ans Herz gewachsenen Figur. Allerdings nur auf dem Papier bei Sibylle Lewitscharoff, denn begegnen möchte er einem soziophoben Kerlchen wie Pong im Leben lieber nicht. Zwischen Büchners Lenz und Woody Allen macht er sich aber gut, meint Wiele. Am meisten schätzt er an der Figur das Kippmoment, also die Bipolarität, in diesem Büchlein zu genießen, als Pong im Krankenhaus, das die Autorin für Wiele schön realistisch beschreibt, um damit die Fantastik etwas zu erden, auf einen Bettgenossen trifft. Famose Figur, famoser kleiner Roman, findet Wiele.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Die dunkelste Nacht wird hell, wenn man dieses schöne Insel-Büchlein liest ...« Jan Wiele Frankfurter Allgemeine Zeitung 20131101