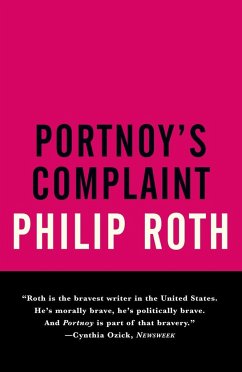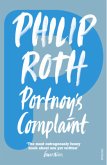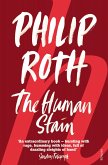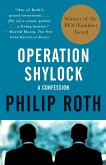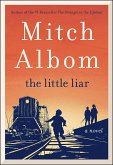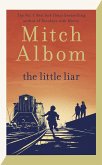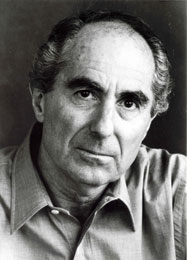The groundbreaking novel that propelled its author to literary stardom: told in a continuous monologue from patient to psychoanalyst, Philip Roth's masterpiece draws us into the turbulent mind of one lust-ridden young Jewish bachelor named Alexander Portnoy. Portnoy's Complaint n. [after Alexander Portnoy (1933- )] A disorder in which strongly-felt ethical and altruistic impulses are perpetually warring with extreme sexual longings, often of a perverse nature. Spielvogel says: 'Acts of exhibitionism, voyeurism, fetishism, auto-eroticism and oral coitus are plentiful; as a consequence of the patient's "morality," however, neither fantasy nor act issues in genuine sexual gratification, but rather in overriding feelings of shame and the dread of retribution, particularly in the form of castration.' (Spielvogel, O. "The Puzzled Penis," Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, Vol. XXIV, p. 909.) It is believed by Spielvogel that many of the symptoms can be traced to the bonds obtaining in the mother-child relationship.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Philip Roth' Sexseller "Portnoys Beschwerden" feiert vierzigsten Geburtstag. Aber braucht er deshalb eine Verjüngungskur?
Von Werner von Koppenfels
Zu den vielen historischen Jubiläen des Jahres noch dieses: Mit "Portnoy's Complaint" feiert ein berühmtes Kultbuch der permissiven Ära seinen Vierzigsten. Nie zuvor wurde mit so viel Sprachwitz zwischen zwei Buchdeckeln so viel masturbiert und kopuliert, von den oralen Exzessen ganz zu schweigen. "Liberate libido" lautet die emanzipatorische Botschaft; die Wortspielerei verweist den alerten Leser auf die sicherheitshalber eingebaute Ironie.
"Befreien Sie die Libido dieses netten Judenjungen", so bestürmt der ewig pubertiernde Alex Portnoy - in diesem Moment dreiunddreißigjährig wie sein Autor und wie dieser gebürtig aus Newark, New Jersey: damals keine feine Adresse - im Verlauf eines fast dreihundertseitigen Couch-Monologs den Psychiater Dr. Spielvogel. Und wenn der unbefangene Leser meint, nach so viel lustvoll protokolliertem Spermenerguss müsste diese Befreiung doch längst erfolgt sein, so hat der den spezifisch jüdischen Witz des Buches nicht begriffen.
Denn Portnoys Beschwerden (im doppelten Wortsinn) und sein unablässiges Hadern mit einem geradezu tantalischen Schicksal rühren eben daher, dass sich sein ungebärdiges Es, auf Englisch kurioserweise "Id" genannt, nie vom Würgegriff des Über-Ichs befreien kann. Letzteres verkörpert sich in einer erdrückend liebevoll-besorgten jüdischen Mamme, die ödipales Begehren nährt und verwehrt, einem an grotesker Dauerverstopfung leidenden bienenfleißigen Vater, dazu in den unzähligen Imperativen der anständigen Gesellschaft und der jüdischen Tabus. Weshalb es höchst unsicher bleibt, ob Dr. Spielvogel den an ihn ergangenen Patientenauftrag "Put The Id Back in Yid" wird erfüllen können.
Roman, Konfession, Pornographie, Satire? Zweifellos ein Mix aus alledem, reich garniert mit jiddischen Brocken. Die Charaktere, vor allem die meschuggen Eltern und eine herrlich ordinäre, dabei durchaus bildungswillige Sexakrobatin (Spitzname: "Das Äffchen"), sind gnadenlos überzeichnet; Karikaturen von romanhafter Vitalität. Portnoy, der Selbstentblößer auf der Couch, ergießt sein Leiden an der Lust in einem schlammig strudelnden Redefluss, dem der Psychiater erst im letzten Satz des Buches Einhalt gebietet.
Wenn Pornographie, Nabokov zufolge, die Kopulation von Klischees bedeutet, dann ist dieser Text, ganz strenggenommen, keine. Zu komisch die eingelagerten Szenen und Dialoge, zu raffiniert das ständige, durch die Sprechsituation bedingte Umherspringen in der Chronologie. Die Wiederholung des Ewig-Gleichen, die bloß quantitative Steigerung des Unanständigen, wird virtuos vermieden. Höhepunkt der Geschichte ist, wie könnte es anders sein, eine Antiklimax. Auf der Flucht vor den willigen, aber allzu heiratswilligen Schicksen lässt den Helden ausgerechnet im Heiligen Land, in Gegenwart der männlich selbstbewussten Töchter des Landes, sein (mit Goethe zu sprechen) Meister Iste schmählich im Stich: Impotent in Israel!
Ein Judenwitz, sagt Portnoy, sei sein Leben - also ein trauriger Witz. Das jüdische Kleinbürger-Milieu, aus dem sich der brillante Alex herausstrampelt und dem er doch nie entrinnt, ist ein Spiegel des guten alten, nicht nur puritanisch verheuchelten Amerika aus der Zeit des Kalten Krieges. Das rebellische Glied erhebt sich als Zeuge der Anklage, und sein Besitzer benimmt sich etwa so geschmackvoll und politisch korrekt wie in unseren Tagen der kasachische Borat. Dazu kommt ein Hang zur Blasphemie, wie er dem erotischen Genre eigen ist, seit Boccaccio die entsprechende Regung am Leib eines frommen Bruders als "Auferstehung des Fleisches" bezeichnet hat. Höhepunkt dieser Verhunzung heiliger Texte ist eine tolle Szene, in der Alex und das Äffchen Yeats' großes Sonett "Leda und der Schwan" zur sexuellen Stimulation missbrauchen: "Liebste! Du hast das Gedicht verstanden!"
Die deutschen Rechte an Philip Roth sind vor einiger Zeit von Rowohlt zu Hanser gewandert. Werner Schmitz, einer der produktivsten unter den qualitätvollen Übersetzern der Gegenwart, hat nun, gleichzeitig mit Roth' jüngstem Roman "Empörung" (F.A.Z. vom 23. März), seinen alten Skandalerfolg neu eingedeutscht. Damit ist Kai Molvigs Erstlingsversion, einst ein Rowohltscher Longseller, dem Vergessen überantwortet. Kein Zweifel: Moderne Klassiker verlangen, wie alle klassischen Texte, von Zeit zu Zeit nach einer Neuübersetzung; und das geschätzte Publikum, so will es naturgemäß der Verlag, soll bitte unbesehen davon ausgehen, dass die neueste Version immer die beste ist. Darf der Rezensent ein bisschen kiebitzen?
Vorweg das Lob. Schmitz übersetzt eine Spur genauer als sein Vorgänger. Er weiß, dass "dormitory" ein Studentenheim ist und kein Schlafsaal, "neighborhood" eher Viertel als Nachbarschaft. Bei Spielvogels nicht ganz akzentfreiem Schlusssatz "So. Now vee may perhaps to begin. Yes?" erhält er den Grammatikverstoß, auch wenn das Ergebnis unweigerlich nach neudeutschem Migrationshintergrund klingt: "Also. Vielleicht wir jetzt können beginnen. Ja?" Auch stilistisch bessert er manches nach. Vor allem meidet er das hässlichste Wort unserer Sprache, Brustwarze, und ersetzt es durch das Lehnwort Nippel. Manchmal ist die Anglisierung des Deutschen ein rechter Segen.
Aber die Wortspiele! Wenn Alex seine gojische Herzensbrecherei als späte Rache für die Ausbeutung des Vaters deklariert, nennt er das, mit einem obszönen Doppelsinn im zweiten Verb, "Hating Your Goy And Eating One Too", nach dem Muster von "having your cake and eating it". Hier kommt jeder Übersetzer an seine Grenzen, aber "Hasse deine Goje und treib's auch mit einer" geht beim besten Willen nicht; ebenso wenig wie "Sie gibt dem Juden sein Es zurück, ich gebe dem Goj sein Leid zurück", wo Molvig dem Jidd sein Id und dem Goj sein oi zukommen lässt.
Generell trifft Molvig den frechen kolloquialen Ton, auf den hier alles ankommt, besser als sein Nachfolger: "Ooohh! Was drücken mich für Kümmernisse! Was hege ich für Abneigungen . . ." klingt spürbar steifer als "Uff! Steck ich voller Ressentiments! Und voller Hassgefühle . . ." Und welcher Teufel ritt den Verlag, Erich Kahlers ungelenke, unmetrische Version von "Leda und der Schwan" in den neuen Text einzurücken, statt die seinerzeit eigens für Portnoy geschriebene, schwungvolle Fassung von Peter Gan? Kahlers Leda als Aphrodisiakum? So sabotiert man einen Autor.
Philip Roth: "Portnoys Beschwerden". Roman. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Hanser Verlag, München 2009. 286 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
The most scandalous book of the year and probably the decade. John Sutherland The Times