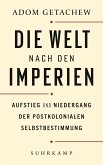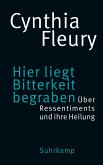Bei der Vorsilbe Post- handelt es sich um die erfolgreichste Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften seit 1945. Zum weltweiten Einsatz kommt sie in Großwörtern wie Posthistoire, Postmoderne oder Postkolonialismus sowie in zahllosen weiteren Kombinationen. Offensichtlich ist es Trend geworden, sich in die Nachzeit einer Vorzeit zu versetzen. Doch nicht hinter jedem Erfolg steckt eine gute Idee. Das ist auch hier der Fall, wie Dieter Thomä in seiner aufregenden Kritik jener Geistes- und Lebenshaltung zeigt, die auf den Post-Weg geraten ist.
Nicht nur zeugt es laut Thomä von epochaler Einfallslosigkeit, ein altes Wort mit Post- zu schmücken und als letzten Schrei auszugeben. Darüber hinaus haben die Post-Theoretiker ein grundsätzliches Problem: Sie lassen etwas hinter sich und schleppen es doch weiter mit. Sie fahren in die Zukunft, schauen dabei aber dauernd in den Rückspiegel. Sie bleiben in der Ambivalenz zwischen Anhänglichkeit und Aufbruch stecken. Höchste Zeit also für die Verabschiedung der Postismen unserer Zeit. Dieses Buch ist ihr Nachruf und zugleich ein Plädoyer für etwas von ihnen Verschiedenes: Geistesgegenwart.
Nicht nur zeugt es laut Thomä von epochaler Einfallslosigkeit, ein altes Wort mit Post- zu schmücken und als letzten Schrei auszugeben. Darüber hinaus haben die Post-Theoretiker ein grundsätzliches Problem: Sie lassen etwas hinter sich und schleppen es doch weiter mit. Sie fahren in die Zukunft, schauen dabei aber dauernd in den Rückspiegel. Sie bleiben in der Ambivalenz zwischen Anhänglichkeit und Aufbruch stecken. Höchste Zeit also für die Verabschiedung der Postismen unserer Zeit. Dieses Buch ist ihr Nachruf und zugleich ein Plädoyer für etwas von ihnen Verschiedenes: Geistesgegenwart.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Rezensent Günter Kaindlstorfer lässt sich vom Philosophen Dieter Thomä Lust auf die Zukunft machen. Schluss mit Post-, ruft Thomä und arbeitet sich laut Rezensent streitbar und durchaus anregend an Begiffen wie Postkolonialismus und Posthistoire ab. Beides gibt es für Thomä eigentlich gar nicht. Weder endet die Geschichte noch trifft der Postkolonialismus-Begriff eine Bewegung, die sich eher in unterschiedlichen Schulen und Fraktionen manifestiert, argumentiert der Autor. Die analytische Hingabe des Autors hat Kaindlstorfer sichtlich beeindruckt. Der Leser braucht allerdings etwas Vorbildung, um an jedem Gedanken im Buch Freude zu haben, gibt der Rezensent zu bedenken.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Man folgt [seiner Argumentation] auch, weil Thomä sie mit Stil und Eleganz entwickelt, ohne Scheu vor Wirklichkeitsbezügen ...« Harald Staun Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20250323