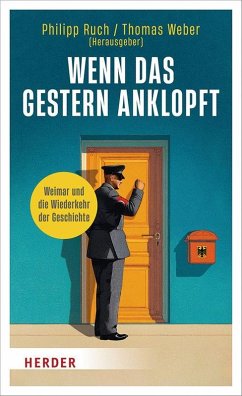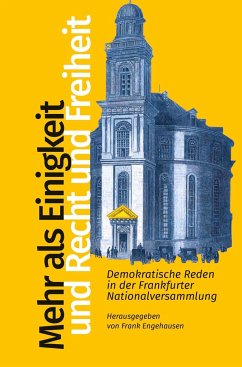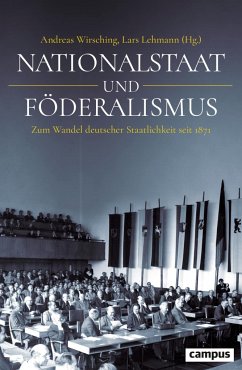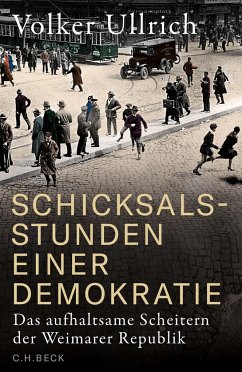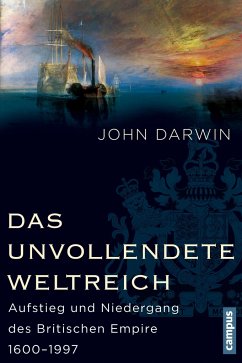Postheroische Demokratiegeschichte

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ute Daniel erzählt eine faszinierende Geschichte vom Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit der parlamentarischen Demokratie und fragt, wie diese Regierungsform so umgestaltet werden kann, dass ihr Ziel nicht vor allem darin besteht, handlungsfähige Regierungen zu bilden.Die heroische Version zur Geschichte der parlamentarischen Demokratie hält sich hartnäckig: Diese Regierungsform habe sich durchgesetzt, weil unsere Vorfahren für ihre Rechte gekämpft haben. Unter dem Druck von Wahlrechts- und Protestbewegungen sei den Herrschenden abgezwungen worden, der breiten Bevölkerung Mit...
Ute Daniel erzählt eine faszinierende Geschichte vom Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit der parlamentarischen Demokratie und fragt, wie diese Regierungsform so umgestaltet werden kann, dass ihr Ziel nicht vor allem darin besteht, handlungsfähige Regierungen zu bilden.
Die heroische Version zur Geschichte der parlamentarischen Demokratie hält sich hartnäckig: Diese Regierungsform habe sich durchgesetzt, weil unsere Vorfahren für ihre Rechte gekämpft haben. Unter dem Druck von Wahlrechts- und Protestbewegungen sei den Herrschenden abgezwungen worden, der breiten Bevölkerung Mitspracherechte einzuräumen.
Tatsächlich gab es diese mutigen Männer und Frauen, diese Protestbewegungen und Wahlrechtskämpfe; ihnen allen jedoch ist gemein, dass ihr Einfluss auf die real existierende Politik des 19. Jahrhunderts marginal war. Die parlamentarische Regierungsform ging aus gänzlich anders gelagerten Gründen hervor. Ihnen geht die Historikerin in ihrer postheroischen Politikgeschichte nach.
Die heroische Version zur Geschichte der parlamentarischen Demokratie hält sich hartnäckig: Diese Regierungsform habe sich durchgesetzt, weil unsere Vorfahren für ihre Rechte gekämpft haben. Unter dem Druck von Wahlrechts- und Protestbewegungen sei den Herrschenden abgezwungen worden, der breiten Bevölkerung Mitspracherechte einzuräumen.
Tatsächlich gab es diese mutigen Männer und Frauen, diese Protestbewegungen und Wahlrechtskämpfe; ihnen allen jedoch ist gemein, dass ihr Einfluss auf die real existierende Politik des 19. Jahrhunderts marginal war. Die parlamentarische Regierungsform ging aus gänzlich anders gelagerten Gründen hervor. Ihnen geht die Historikerin in ihrer postheroischen Politikgeschichte nach.