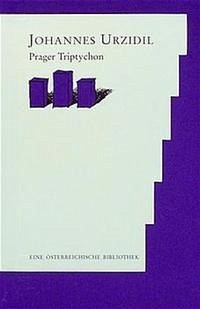Prag zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Menschen, die mit schwejkschen Listen kafkaeske Abenteuer bestehen - ein Meisterwerk erzählender Kunst Wie die Teile eines Flügelaltars wollte Johannes Urzidil diese Erzählungen angeordnet wissen. Mehr noch als durch die Form sind sie aber durch den Ord der jeweiligen Handlung verbunden: Prag zu Anfang des 20. Jahrhunderts, als man in den Kaffeehäuserd der Stadt unter dem Hradschin noch Werfel, Brod, Kisch und Kafka begegnen konnte. Im "Relief der Stadt" erinnert sich Urzidil an die Orte seiner Kindheit, wo die Deutschen die Tschechen befehdeten und die Tschechen die Deutschen und alle gegen die Juden waren. Die "Seitentafeln" schildern einen sich abahnenden skurrilen Rechtsstreit von kohlhassischen Dimensionen zwischen einem Prager Bürger und dem Magistrat beziehungsweise die letzte Lebensphase des Dichters Karl Brand, dessen Tod als Symbol für den Untergang einer enthusiastischen Schriftstellergeneration gesehen werden kann. Im "Schrein" schließlich - einem wahren Kabinettstück erzählerischer Kunst - diktiert "Weißenstein Karl", eine Figur zwischen Erfindung und Realität, "vom Weltgebäude herab oder hinab" die Geschichte eines ebenso abenteuerlichen wie banalen Lebens, das die Welten Haseks und Kafkas vereinigt. Mit schwejkischer List meistert Weißenstein Not, verworrene Liebesbeziehungen und die Wechselfälle des Daseins. Im abschließenden "Gesprenge" beschwört Urzidil mit einem unheimlichen Operntraum noch einmal die Stadt seiner Jugend.

Mythenkundig: Johannes Urzidils "Prager Triptychon"
Als Johannes Urzidil Anfang November 1970 im österreichischen Kulturinstitut in Rom über Nacht gestorben war und auf dem Campo Santo Teutonico begraben wurde, rühmte ihm Hilde Spiel in dieser Zeitung nach: "Zweifellos war Urzidil einer der letzten großen Erzähler alten Stils, ein Fabulierer von hohen Graden, der eine klare, reine, transparente Diktion mit größter sinnhafter Anschaulichkeit verband." Jedes Wort daran stimmt, die Charakterisierung dürfte freilich auch auf manch anderen Autor zutreffen. Urzidil, oft zur Randfigur des "Prager Kreises" degradiert, ist indes eine singuläre, nicht zuletzt aufgrund seines Schicksals unverwechselbare Erscheinung gewesen. Der im Jahre 1896 geborene Sohn einer jüdischen Mutter und eines deutschnationalen Beamten hatte sich als Lyriker und Essayist einen Namen gemacht. Obwohl tschechoslowakischer Staatsbürger, arbeitete Urzidil bis über Hitlers Machtergreifung hinaus als Presseattaché an der deutschen Gesandtschaft in Prag. Seine Liebe im Literaturbezirk galt Goethe und Stifter. Diesem hat er die schöne Novelle "Der Trauermantel" (1945) gewidmet, jenem die erstmals im Jahr 1932 veröffentlichte Monographie "Goethe in Böhmen".
Im Jahre 1939 entkam das Ehepaar Urzidil - seine Frau Gertrud stammte aus einer angesehenen Rabbinerfamilie, ihr Bruder war Kafkas Hebräischlehrer - mit knapper Not den Nazischergen. Der Weg der Vertriebenen führte über Italien und England 1941 nach New York. Die Vereinigten Staaten blieben Zufluchtsland, geistiges oder gefühlsmäßiges Zuhause wurden sie nie. Das Bekenntnis: "Meine Heimat ist, was ich schreibe", entbehrte jeglicher Koketterie. Denn erst in der Fremde, als Emigrant und insbesondere nach dem Krieg, fand der Schriftsteller Johannes Urzidil zu seiner eigentlichen Berufung: Geschichte um Geschichte wuchs da eine unsentimentale Erinnerungsprosa, die das Verlorene wiederzugewinnen und zu bewahren trachtete. Daß der Erzähler Urzidil in den fünfziger Jahren im deutschen Sprachraum populär wurde, ist vor allem dem enthusiastischen Einsatz des Zürcher Kritikers Hans Jacobi zu danken.
Den Kakanier mit amerikanischem Paß hat das neue Österreich dann rasch einzugemeinden versucht. Der ließ es sich gerne gefallen und nahm den Professorentitel ebenso bereitwillig entgegen wie den bedeutendsten Literaturpreis der Republik, mit dem er als "legitimer Repräsentant des alten Österreich" gewürdigt wurde. Auf dem Höhepunkt seines späten Ruhms meinte er: "Ich werde nunmehr von Deutschen, Schweizern, Österreichern, Sudetendeutschen, Tschechen, Katholiken, Protestanten, Juden und Amerikanern reklamiert" - das Los eine Kosmopoliten, der sich selbst als "hinternational" zu bezeichnen pflegte. Nach seinem Tod aber geriet Urzidils OEeuvre, weil im Ruf des kultiviert Altmodischen und unter Nostalgieverdacht stehend, zusehends ins Abseits. Um so erfreulicher, daß Peter Demetz nun im Rahmen der "Österreichischen Bibliothek" ein episches Glanzstück dieses bemerkenswerten Mannes vorlegt.
Formal betrachtet, könnte das "Prager Triptychon" aus dem Jahre 1960 in seiner Nachbildung eines mittelalterlichen Flügelaltars den Eindruck einer feinen Antiquität erwecken. Bei genauerem Lesen wird jedoch heute kaum jemand auf einen solchen Gedanken verfallen. Denn hier ist ein kunstverständiger Erzähler mit scheinbar unangestrengter, spielerischer Virtuosität am Werk. Aus Mythos und Historie, aus Realität und Fiktion spinnt er das Gewebe seiner dichten, schimmernden Sätze. Als Staffel des Triptychons dient ein sehr persönliches Panorama der Moldaustadt. Ohne Verklärung vermittelt es den unheimlichen Zauber Prags, auch und gerade mit der Legende vom "Landeskanzleioberaktuar Suchy", der im Wahn die Nachfolge der böhmischen Könige anzutreten glaubt. Die "Causa Wellner", gleichsam als linke Tafel des Altars angeordnet, berichtet vom bizarren Rechtsstreit eines Prager Bürgers und - damit verschränkt - vom seelischen Zerbrechen eines Pubertierenden an den frommen Lügen der Erwachsenen. Am Schluß des Bandes beschwört Urzidil den Schrecken der Sterbenseuphorie des frühverblichenen Dichters Karl Brand sowie eine Wachtraumszene rund um Mozarts "Zauberflöte".
Am meisten aber fasziniert der farbenprächtige "Schrein", das wundersame Lebensporträt eines grotesken Sonderlings aus dem Milieu der Prager Expressionisten im Café Arco: "Weißenstein Karl". Seine Existenz ist verbürgt. Willy Haas erwähnt ihn in seinen Memoiren, und Franz Werfel hat ihn in dem kurzen Text "Weißenstein, der Weltverbesserer" als "Charge, eine Nebenrolle in Gottes großer Tragikomödie" verewigt. Aber nur Johannes Urzidil gelang es, die Gestalt behutsam aus ihrer schemenhaften Lächerlichkeit zu erlösen. Sie wird zum traurigen, berührenden Gleichnis für das Vergebliche aller hochfliegenden Ambitionen. Max Brod nannte Urzidil einmal den Troubadour des versunkenen Prag, und für Franz Carl Weiskopf war er der "Menschheitsdämmerer" schlechthin. Im "Prager Triptychon" ist der poetische Prosaist beides zugleich gewesen. Die Melodie seiner Sprache hat nicht minder bezwingenden Reiz als die kluge Nachdenklichkeit des Humanisten Johannes Urzidil. ULRICH WEINZIERL
Johannes Urzidil: "Prager Triptychon". Erzählungen. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter Demetz. Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1997. 240 S., geb., 47,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main