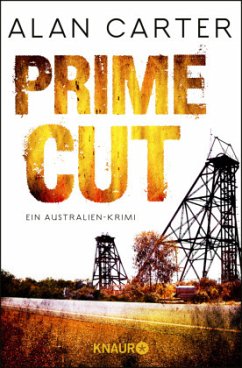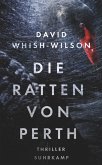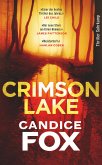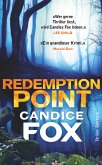Schnelles Geld, mafiöse Strukturen, Korruption in der Polizei und Rassismus - Alan Carter zeichnet in seinem Kriminalroman "Prime Cut" das erschreckende Bild einer Boomtown im australischen Outback, unter deren Oberfläche es gefährlich brodelt.
"Man hatte ihn abserviert, weil er faul, schludrig, inkompetent, arrogant und korrupt gewesen war." Cato Kwong, früher ein aufgehender Stern am australischen Polizeihimmel, ist auf dem Abstellgleis der Kriminalpolizei gelandet: beim Viehdezernat. Als in Hopetoun, einer boomenden Kleinstadt in West-Australien, eine Leiche ohne Kopf angespült wird, bekommt er seine zweite Chance. Sonnenschein und Meer - nicht die schlechtesten Bedingungen für die Aufklärung eines Mordfalls. Der Kaffee und die Leute sind allerdings ziemlich mies. Schnell wird Cato klar, dass der Aufschwung in Hopetoun seinen Preis hat: Mit ihm gehen Korruption, Ausbeutung und Rassismus einher.
"Eine frische, rauhe Stimme im australischen Crime Beat" - KrimiZeit-Bestenliste
"Man hatte ihn abserviert, weil er faul, schludrig, inkompetent, arrogant und korrupt gewesen war." Cato Kwong, früher ein aufgehender Stern am australischen Polizeihimmel, ist auf dem Abstellgleis der Kriminalpolizei gelandet: beim Viehdezernat. Als in Hopetoun, einer boomenden Kleinstadt in West-Australien, eine Leiche ohne Kopf angespült wird, bekommt er seine zweite Chance. Sonnenschein und Meer - nicht die schlechtesten Bedingungen für die Aufklärung eines Mordfalls. Der Kaffee und die Leute sind allerdings ziemlich mies. Schnell wird Cato klar, dass der Aufschwung in Hopetoun seinen Preis hat: Mit ihm gehen Korruption, Ausbeutung und Rassismus einher.
"Eine frische, rauhe Stimme im australischen Crime Beat" - KrimiZeit-Bestenliste

Eine Boomtown am Rande der bewohnten Welt wird aufgerieben durch Gier und Gewalt, Rassismus und Rache: Dem Australier Alan Carter gelingt mit "Prime Cut" ein überzeugendes Debüt.
Hopetoun also. Sogar das China-Restaurant nennt sich "The Taste of Toun". Wie spricht man das also aus - Hopetoon wie in Cartoon, oder wie Hopetown? Der Volksmund sagt einfach Hopey. "Die älteren Einheimischen sagen Hopet'n, sie verschlucken also den letzten Vokal. Aber die Zugezogenen sind ihnen inzwischen zahlenmäßig überlegen, deswegen kannst du ihn aussprechen wie du willst, Hauptsache, du zahlst." So weit Tess Maguire, eine traumatisierte Ortspolizistin, zu Philipp "Cato" Kwong, auch er ein Polizist mit Blessuren. Einst war er wegen seines asiatischen Migrationshintergrundes das Plakatmotiv für die Polizeiwerbung, dann kegelte er sich durch eigenes Unvermögen aus der Karrierebahn: Nun schiebt er Dienst im Viehdezernat. Man hofft, dass er von selbst kündigt.
Dann spült es in Hopey einen Kadaver an Land, der sich als menschlicher Torso entpuppt. Dem nicht Haie, sondern ein scharfes Messer den Kopf abtrennte. Der wird dann in einer Felsenhöhle von einem Ranger gefunden. Wenig später gibt es eine zweite Leiche, die aber auf eine ganz andere Spur führt, einen "cold case" aus dem Jahr 1973 in England. Der ehemalige Polizist Stuart Miller, zwischenzeitlich nach Australien ausgewandert, jagt seit vierzig Jahren den Mörder seiner Frau und seines Sohnes. Als die australische Polizei einen Fall aus dem Jahr 1981 wiederaufnimmt, ahnt Miller dass er dem Serienmörder, der seine Opfer mit Strom tötet, auf der Spur ist. Aber der Täter ist ziemlich abgebrüht.
Hopetoun. Das Kaff. Das frühere Fischerdorf. Jetzt wird es zugemüllt mit "wuchernden, gesichtslosen Legoland-Neubausiedlungen" und Gewerbegebieten. Es hat das Zeug zur Verbrechenshauptstadt im entlegenen Südwesten Australiens. Sechshundert Kilometer südöstlich von Perth, eine Boomtown im Zangengriff von Geldgier und Gewaltbereitschaft. Eine Nickelmine in der Nachbarschaft verspricht Reichtum für mindestens fünf Jahrzehnte - aber nur für wenige Auserwählte, die anderen sind die Opfer des immer gleichen Sklaven- und Ausbeutersystems: chinesische Wanderarbeiter mit befristeter Arbeitsgenehmigung. Sie werden von allen Seiten ausgenommen und geprellt; zu ihnen gehörte offenbar auch der Ermordete. Die Umstände seines Ablebens darf Cato nur deswegen ermitteln, weil die nächste Mordkommission nicht abkömmlich ist. Dass er einst ein Verhältnis mit Tess abrupt beendete, macht die Sache nicht einfacher.
Alan Carter, 1959 im nordenglischen Sunderland geboren und 1991 nach Australien ausgewandert, reiht sich ein in die Riege von zugezogenen Autoren, angeführt von Peter Temple, die auf der Weltkarte des Krimis Ehre für Down Under einlegen. Zumal es sich um sein Debüt handelt. Zwar hat Carter Erfahrung als Autor der aus England importierten Fernsehserie "Who do you think you are?" gesammelt, in der Prominente den Verzweigungen ihres Stammbaums nachforschen. Zum Romancier aber wurde er erst, als seine Frau eine Lehrerstelle in Hopetoun annahm. Sein Roman gewann vor vier Jahren den Ned Kelly Crimewriting Award, ein zweiter Roman mit Cato Kwong ("Getting Warmer") ist 2013 erschienen, der dritte ("Bad Seed") folgt in diesem Jahr. Cato bleibt, Fremantle ersetzt Hopetoun, weil das Kaff nicht noch mehr fiktive Morde aushalten würde.
Und auch wenn Carter bei seinem Debüt mit erstaunlicher Übersicht und Routine zu Werk geht, ist bei der sprachlichen Ausdruckskraft noch Luft nach oben. Dialoge kann er, die Figuren und ihr Innenleben beherrscht er auch, die Schilderung von Landschaft und Ozean ist verbesserungsfähig. Ein ums andere Mal kommt Carter auf "das leuchtend blaue Südpolarmeer" zu sprechen, das sich bis zur Antarktis spannt, und auch der Nationalpark Fitzgerald River und die Barren Mountains bergen mehr Drohpotential. Denn der Mensch ist in dieser Szenerie nur Beiwerk, so weit und groß ist die Leere.
Aber das sind Einwände, die Alan Carters Leistung, Bilder zu schaffen, die man nicht sofort vergisst, nicht schmälern. Er zeichnet das Bild einer unfertigen Gesellschaft, die das Ausleben ihrer verrohten Sitten als Wertevermittlung für die eigenen Nachkommen begreift. Immer wieder läuft Cato aufgrund seines Aussehens in die gezückten Messer des Rassismus, da geht es ihm nicht besser als den wenigen Maori. Die Polizei ist den Umständen angepasst und also korrupt, und der örtliche Geldadel behindert die Ermittlungen, wo er kann. So ist "Prime Cut" auch das Porträt einer Gesellschaft, deren Nahrungskette klare Hierarchien kennt.
HANNES HINTERMEIER
Alan Carter: "Prime Cut". Kriminalroman. Aus dem Englischen von Sabine Schulte. Edition Nautilus, Hamburg 2015. 368 S., br., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Sperrfeuer
„Prime Cut“ von Alan Carter möchte
besonders hart und böse sein
VON NICOLAS FREUND
Zuerst denken alle, dass es die Haie waren. Eine Kleinstadt im australischen Outback: Hopetoun – ausgesprochen nicht wie Hopetown, sondern mit angedeutetem „o“ und als habe man alle anderen Vokale verschluckt: Hoptn. Dank der boomenden Nickelmine stehen neuerdings Strandvillen und Yachten an der Südpolarmeerküste. Die Polizeistation ist ein Container neben dem Gemeindezentrum und das nächste Krankenhaus ist eine gute halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Wenn man schnell fährt.
Vom Strand aus kann man mit etwas Glück spielende Seelöwen und Delfine beobachten, obwohl die Delfine eigentlich zwei Haie sind und der Seelöwe nur noch ein Brocken Fleisch. Alan Carters Erzähler ist böse: Dem Leser wird eine heile Welt vorgeführt, nur um diese dann kippen zu lassen wie eine optische Täuschung. Aus den weiß-roten Vereinsfarben eines Fußballtriumphes wird ein Blutbad im Familienwohnzimmer, und der geschundene Seehund verwandelt sich in einen menschlichen Rumpf – ohne Arme, ohne Beine, ohne Kopf –, der am Strand von Hopetoun im groben Sand liegt.
Schnell wird klar: Auch die Haie sind für den Mord nicht verantwortlichen zu machen. Der südafrikanische Gerichtsmediziner sieht sofort, dass mindestens der Kopf des Toten mit einem scharfen Werkzeug entfernt wurde. Die paar Outback-Polizisten um Detective Cato Kwong und seine Kollegin Tess Maguire kümmern sich sonst nur um Raser, Säufer und Tierquäler. Wenn überhaupt etwas passiert. Nach dem Wirtschaftsboom scheint jetzt für die kleinen Cops die große Bewährungschance gekommen zu sein.
Denn dieser Cato hatte es eigentlich schon ein paar Mal fast bis ganz nach oben geschafft: Erst als Teenager im Klavierspiel. Damals versagte er, trotz Talent, beim Vorspiel kläglich. Dann war er als angehender Detective, Nachfahre eingewanderter Asiaten, das Gesicht einer landesweiten Diversitäts-Werbekampagne für den Polizeidienst und wurde von seinen Vorgesetzten entsprechend hofiert. Auch diese Chance setzte er allerdings mit einem fahrlässig falschen Ermittlungsergebnis spektakulär in den heißen australischen Sand. Inzwischen gibt er sich mit einem guten Kaffee zufrieden, aber selbst den aufzutreiben, gelingt ihm nur selten. Sein Job in Hopetoun ist eigentlich beim Viehdezernat, nicht bei der Mordkommission. Er soll kontrollieren, dass die Schafe und Rinder auf den umliegenden Farmen artgerecht gehalten werden. Werden sie in diesem Roman übrigens durchweg nicht, aber das ist nur einer der kleineren Abgründe, in die der Text blickt.
„Prime Cut“ ist der erste von inzwischen drei Thrillern um diesen verlorenen Detective Cato Kwong, und er erzählt gleich von zwei Kriminalfällen: 35 Jahre bevor der gliederlose Torso in Westaustralien an den Strand gespült wird, steht der Polizist Stuart Miller im weit entfernten England fassungslos vor den brutal zugerichteten Leichen einer jungen Mutter und ihres kleinen Sohnes. Den Täter, den Ehemann, fasst er nie. Aber der Fall lässt ihn auch nie los. Bis er, inzwischen im Rentenalter, in Australien selbst die Ermittlungen wieder aufnimmt. Durch einen Zeitungsartikel meint er, auf eine neue, die richtige Fährte gekommen zu sein.
Diese zweite Krimihandlung schwebt merkwürdig über dem eigentlichen Plot um den Toten am Strand. Parallel zu den Ermittlungen von Detective Cato ist der alte Miller dem Täter von damals auf der Spur, den es offenbar, wie ihn selbst, von England ans andere Ende der Welt verschlagen hat. Die Fälle scheinen miteinander nichts zu tun zu haben, aber dann kreuzen sie sich doch, als es einen weiteren Toten gibt – was die beiden Verbrechen aber nur noch undurchschaubarer werden lässt.
In die zwei Ermittler, Cato und Miller, hat Alan Carter seine eigene Biografie einfließen lassen. Wie die Figur des deutlich älteren Miller emigrierte er vor fast 25 Jahren von England aus freiwillig nach Australien. Wie Cato scheint er im australischen Hinterland ein Fremdkörper zu sein: denn wer hier Polizeidienst schiebt, wird Carter nicht müde festzustellen, den hassen seine Vorgesetzten. Und wer auch noch einen englischen Akzent hat – also Hopetown und nicht Hoptn sagt –, der fällt erst recht auf.
Carter selbst ist hauptberuflich Dokumentarfilmer. Und das Filmische merkt man seinem Roman an. Ein visueller Refrain von Rot und Weiß zieht sich durch das Buch und die Kapitel reiht Carter wie im Schneideraum aneinander, oft ein Motiv aus der vorangegangenen Szene wieder aufgreifend oder den Dialog scheinbar im nächsten Kapitel weiterlaufen lassend: Das ist rasant, sorgfältig arrangiert und sorgt mit viel Sarkasmus des Erzählers für einen harten Ton, als meine Carter, allen anderen Thrillerautoren da draußen mal zeigen zu müssen, was eigentlich abgeht. Das schafft auch die deutsche Übersetzung wiederzugeben, obwohl sie zwangsläufig etwas das Tempo rausnimmt.
Ganz hält Carter diesen Sound aber nicht durch über die 350 Seiten seines ersten Romans. Irgendwann wird er von den Weltproblemen schwer belastet, die er sich, neben der gedoppelten Krimihandlung, aufgeladen hat: die Schattenseiten der Globalisierung, Polizeikorruption, Alltagsrassismus und der Ursprung aller Gewalt – der bei Carter stets in der Kindheit liegt. Alles wird exemplarisch an seinen Figuren durchgespielt: Cato muss sich anhören, warum er denn trotz der offensichtlichen äußeren Ähnlichkeiten sich nicht mit den chinesischen Gastarbeitern verständigen kann. Seine Kollegin Tess ist nach einem Überfall völlig traumatisiert, verrichtet aber weiter Dienst, als sei nichts vorgefallen, während zu Hause die Teenager-Tochter ins Drogenmilieu abrutscht.
Der Leser fühlt sich bald, als müsse er unter Sperrfeuer mit Marschgepäck einen Stacheldrahtparcours überstehen. Zumal Carter seinen bösen Stil schnell der Routine opfert. Ein Thriller, der härter, böser, brutaler als alle anderen sein wollte, ist dann doch wie alle anderen geworden.
Ein paar Mal schon versagte
der Detective – das erste Mal
als Kind, beim Klavierspielen
Alan Carter:
Prime Cut.
Aus dem Englischen
von Sabine Schulte.
Edition Nautilus, Hamburg 2015. 368 Seiten. 19,90 Euro. E-Book 17,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als Porträt einer Gesellschaft der Hierarchien bezeichnet Hannes Hintermeier Alan Carters Down-Under-Krimi. Rassismus spielt eine Rolle, gegen Asiaten und die Maori, und ein "cold case" aus den 70ern, eine Mordserie schließlich. Dass der Autor schon in seinem nun auf Deutsch vorliegenden Debüt die Genreregister beherrscht und wie Peter Temple den genius loci genau kennt und als Handlungsort fruchtbar macht, merkt Hintermeier schnell. Übersicht, Routine, Dialogfestigkeit und eine Hand für starke Bilder attestiert er dem Autor. Bei den Landschaftsbeschreibungen sieht er allerdings noch Entwicklungspotenzial.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH