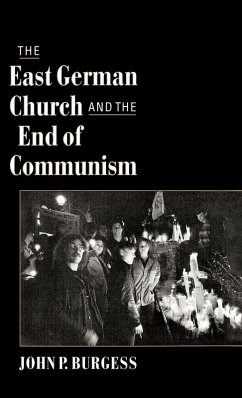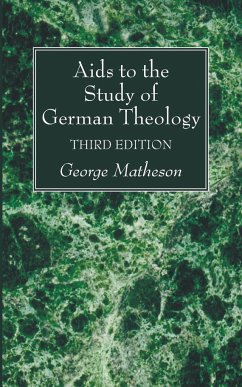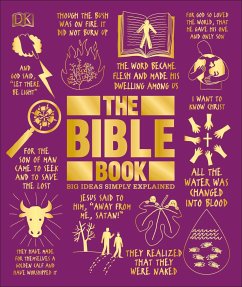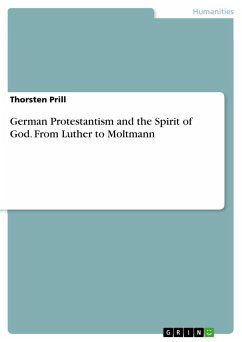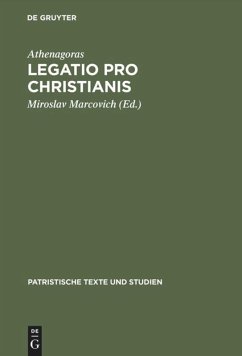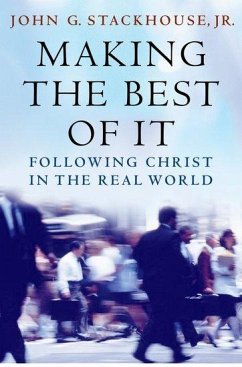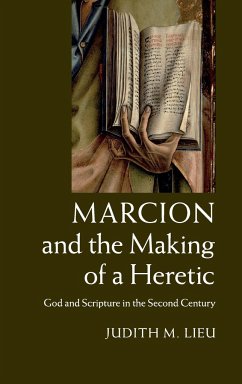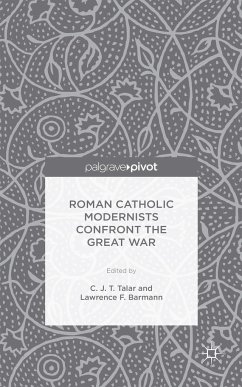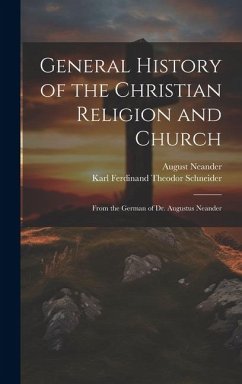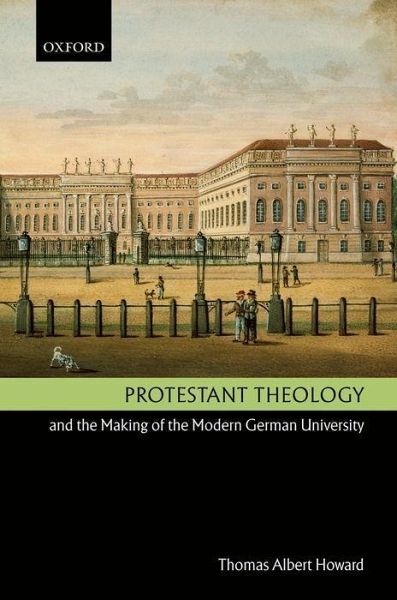
Protestant Theology and the Making of the Modern German University
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
138,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
69 °P sammeln!
In shaping the modern academy and in setting the agenda of modern Christian theology, few institutions have been as influential as the German universities of the nineteenth century. This book examines the rise of the modern German university from the standpoint of the Protestant theological faculty, focusing especially on the University of Berlin (1810), Prussia's flagship university in the nineteenth century. In contradistinction to historians of modern higher education who oftenoverlook theology, and to theologians who are frequently inattentive to the social and institutional contexts of re...
In shaping the modern academy and in setting the agenda of modern Christian theology, few institutions have been as influential as the German universities of the nineteenth century. This book examines the rise of the modern German university from the standpoint of the Protestant theological faculty, focusing especially on the University of Berlin (1810), Prussia's flagship university in the nineteenth century. In contradistinction to historians of modern higher education who often
overlook theology, and to theologians who are frequently inattentive to the social and institutional contexts of religious thought, Thomas Albert Howard argues that modern university development and the trajectory of modern Protestant theology in Germany should be understood as interrelated
phenomena.
overlook theology, and to theologians who are frequently inattentive to the social and institutional contexts of religious thought, Thomas Albert Howard argues that modern university development and the trajectory of modern Protestant theology in Germany should be understood as interrelated
phenomena.