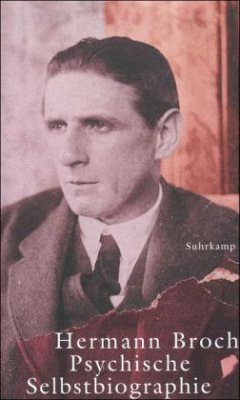In den Jahren 1941-1943 schrieb Hermann Broch, jeweils im Jahresabstand, seine "Autobiographie als Arbeitsprogramm", die "Psychische Selbstbiographie" sowie den "Nachtrag zu meiner psychischen Selbstbiographie". Alle drei Texte - die beiden letztgenannten bislang unveröffentlicht -, werfen ein besonderes Licht auf den österreichischen Romancier, den nicht nur Milan Kundera für einen der bedeutendsten Autoren unseres Jahrhunderts hält.
Im Mittelpunkt steht die "Psychische Selbstbiographie". In ihr entdeckt sich ein "Ich", das sich einer "Überleistung" gegenübersieht, die "keinen Platz" mehr läßt für das eigentliche Leben. Woraus für Broch, der in erster Linie sein Verhältnis zu Frauen zu klären versucht, ein geradezu neurotischer Leistungszwang auch im Erotischen folgt, der ihn die ersehnte monogame Bindung nicht finden läßt. Was ihn freilich nicht hindert, seine Idee von der "Idealfrau" zu entwickeln, die "absolute Liebe" einer "Wunderfrau" zu ersehnen, von der allein die "Erlösung zur Normalität" zu erwarten sei.
Brochs Schrift ist Männerprojektion und radikale Selbstbespiegelung zugleich. Hatte es sich Broch noch nicht erlaubt, in der Autobiographie als Arbeitsprogramm, wo er sich den Themen Demokratie und Menschenrechte widmet, auf eigene Bedrängnisse einzugehen, konzentriert er sich in der Psychischen Selbstbiographie ganz persönlicher Lebensumstände und sehr subjektiver Empfindungen im Exil.
Im Mittelpunkt steht die "Psychische Selbstbiographie". In ihr entdeckt sich ein "Ich", das sich einer "Überleistung" gegenübersieht, die "keinen Platz" mehr läßt für das eigentliche Leben. Woraus für Broch, der in erster Linie sein Verhältnis zu Frauen zu klären versucht, ein geradezu neurotischer Leistungszwang auch im Erotischen folgt, der ihn die ersehnte monogame Bindung nicht finden läßt. Was ihn freilich nicht hindert, seine Idee von der "Idealfrau" zu entwickeln, die "absolute Liebe" einer "Wunderfrau" zu ersehnen, von der allein die "Erlösung zur Normalität" zu erwarten sei.
Brochs Schrift ist Männerprojektion und radikale Selbstbespiegelung zugleich. Hatte es sich Broch noch nicht erlaubt, in der Autobiographie als Arbeitsprogramm, wo er sich den Themen Demokratie und Menschenrechte widmet, auf eigene Bedrängnisse einzugehen, konzentriert er sich in der Psychischen Selbstbiographie ganz persönlicher Lebensumstände und sehr subjektiver Empfindungen im Exil.

Hermann Brochs Selbstbiographie · Von Eberhard Rathgeb
In ihrer Einleitung zu den Essay-Bänden von Hermann Broch, die 1955 unter dem Titel "Dichten und Erkennen" und "Erkennen und Handeln" erschienen, unterschied Hannah Arendt zwischen einem Lebenskonflikt, von dem sich Broch herausgefordert sah, und dem, mit einem Worte des Schriftstellers, "Seelenlärm", der ihn umtrieb. Der Grundkonflikt seines Lebens sei gewesen, daß er ein Dichter war und doch kein Dichter sein wollte. Die Anforderungen unterschiedlicher Begabungen, einer "wissenschaftlich-mathematischen" und einer "dichterisch-visionären", hätten keine entscheidende Rolle gespielt. Ein solcher Konflikt könne nicht "der Grundzug des Wesens eines Menschen sein", das eine Schicht tiefer liege als die Talente, die aus ihm erst hervorgehen. Der Umkreis von Leben und Arbeiten, in dem sich Brochs Werk bewegte, sei kein Kreis gewesen, sondern gliche einem Dreieck, dessen Seiten Hannah Arendt mit Dichten - Erkennen - Handeln beschrieb.
Daß diese drei Tätigkeiten des Menschen zusammenfallen müßten, so Hannah Arendt, habe Broch zwar nicht ausgesprochen. Doch mit dieser "Forderung an den Menschen und an sein irdisches Leben", die sich überall "latent" geltend machte, sei Broch "auf die Welt gekommen". Eine solche Forderung mußte zu einem "Lebenskonflikt" führen, vor allem weil es keine entsprechenden Berufe gab.
Die von Paul Michael Lützeler herausgegebene "Psychische Selbstbiographie" entstand 1942 und ist nun zum ersten Mal veröffentlicht. Broch hatte 1943 seine Psychoanalyse bei Paul Federn begonnen. Bei der Analytikerin Hedwig Schaxel war er seit 1927 für acht Jahre in Behandlung gewesen. Als er am 30. Mai 1951 an einem Herzschlag starb, bemerkte Hannah Arendt, er habe seine Arbeit "Atlas-gleich auf seinen Schultern" getragen, bis er unter ihr zusammengebrochen sei. Acht Tage vor seinem Tod gestand er Hannah Arendt, daß ihm in seinem "psychosomatischen Geschaukel unheimlich zumute" sei. Es sehe wie eine körperliche Müdigkeit aus, doch es stecke mehr dahinter.
In einem Nachtrag zu seiner psychischen Selbstbiographie erwähnte er, daß ihn ein unüberwindlicher Widerstand gegen die Analyse quäle. "Paradox und grotesk ausgedrückt: meine Neurose scheint jede Analyse zu verhindern." Hermann Broch war seiner selbst, seiner inneren Kämpfe müde. Sein Leben sei, beginnt er seine Selbstbeschreibung, von "ständigen moralischen Konflikten begleitet und belastet". Ein "schlichtes, menschliches Glücksgefühl" sei ihm beinahe unbekannt.
Paul Michael Lützeler hat der "Psychischen Selbstbiographie" einen anderen Text von Hermann Broch nachgestellt, die "Autobiographie als Arbeitsprogramm", die 1941 geschrieben worden war und auch in der Kommentierten Werkausgabe zu finden ist. Der Herausgeber rechtfertigt die Zusammenstellung beider Texte damit, daß weder der eine noch der andere den traditionellen Vorstellungen einer Autobiographie, die Leben und Werk zusammen sehe, entgegenkomme. Broch trenne zwischen der Darstellung der ihn beschäftigenden Gedanken und der Analyse der ihn umtreibenden Konflikte.
Man wird dieses Doppelporträt mit Gewinn lesen, wenn man das Arbeitsprogramm im Hintergrund nicht aus den Augen verliert, vor dem sich das Seelendrama abspielt. Erst dann wird man ermessen, was es für Broch hieß, sich seiner Arbeit nicht mit ganzer Kraft zu widmen, was es für ihn bedeutete, seiner Seele sich nicht mit der Kraft bemächtigen zu können, mit der er sich die Außenwelt und ihm fremde Weltentwürfe in seinem literarischen und essayistischen Werk erschloß.
Hermann Broch wurde am 1. November 1886 in Wien geboren und ging den Weg, den sein Vater, ein jüdischer Textilgroßhändler, ihm vorgab. Er studierte Textilwissenschaft und wurde leitender Verwaltungsrat in der Spinnfabrik "Teesdorf" bei Wien, die sein Vater gekauft hatte. Er trat zum katholischen Glauben über und heiratete im Dezember 1909 Franziska von Rothermann, die Tochter eines Zuckerfabrikanten. Im Oktober 1910 wurde ein Sohn geboren. Broch veröffentlichte 1913 seine ersten Arbeiten. 1918 lernte er die elf Jahre ältere Ea von Allesch kennen, die aus einem Proletarierhaushalt stammte. Zehn Jahre lang war sie, die als Modeschriftstellerin arbeitete und im Café Central umschwärmt wurde, seine Geliebte. Er schrieb ihr Briefe bis zu seinem Tod. Seine Ehe wurde 1923 geschieden.
Hermann Broch nahm 1925 sein Studium der Philosophie, Mathematik und Physik auf. Zwei Jahre später verkaufte er die Spinnfabrik. Seine Roman-Trilogie "Die Schlafwandler", von der Kritik stark beachtet, erschien 1931. Broch hielt Vorträge, schrieb Rezensionen und Essays. Der Roman "Die Verzauberung" erschien 1936, ein Jahr darauf die Urfassung des Vergil-Romans und eine antifaschistische Völkerbund-Resolution. 1939 verließ er Österreich und ging über England in die Vereinigten Staaten. Dort arbeitete er an dem Projekt "The City of Man. A Declaration on World Democracy" mit und half unermüdlich dabei, Flüchtlingen Visa und Affidavits zu beschaffen. Er erhielt Stipendien, so für seine Studien zur Massenwahntheorie. Seine Mutter starb im Oktober 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt.
Der Roman "Der Tod des Vergil" kam 1945 auf deutsch und englisch heraus. Vier Jahre später begann Hermann Broch mit einem neuen Roman, "Die Schuldlosen". Er heiratete noch einmal, die Malerin Anne Marie Meier-Graefe, die Witwe des Kunsthistorikers und Schriftstellers Julius Meier-Graefe. Hermann Broch schrieb ohne Unterlaß, über Literatur, Politik, Ästhetik, Philosophie.
Seine "Autobiographie als Arbeitsprogramm" beginnt Broch mit dem Satz: "Dies ist nur insoweit meine Autobiographie, als damit die Geschichte eines Problems erzählt wird, das zufällig mit mir gleichaltrig ist, so daß ich es - wie übrigens ein jeder aus meiner Generation, der es zu sehen gewillt gewesen ist - stets vor Augen gehabt habe; es ist, ohne Umschweife herausgesagt, das Problem des Absolutheitsverlustes, das Problem des Relativismus, für den es keine absolute Wahrheit, keinen absoluten Wert und sohin auch keine absolute Ethik gibt, kurzum, es ist das Problem und das Phänomen jenes gigantischen Machiavellismus, der geistig sich seit etwa fünfzig Jahren vorbereitet hat und dessen apokalyptische Folgen wir heute in der Realiät erleben."
Man könnte auch sagen: Die psychische Selbstbiographie war nur insoweit Brochs Selbstbiographie, als darin die Geschichte eines Konflikts erzählt wurde, der zufällig mit ihm gleichaltrig war, so daß er ihn stets vor Augen hatte. Es war das Problem des Selbstverlustes, des Relativismus der eigenen Erkenntnis, des eigenen Wollens nicht nur gegenüber den Anforderungen eines relativistischen Universums, sondern gegenüber einer Innenwelt, die durch die Psychoanalyse terminologisch hochgerüstet war und in deren Bereich es keine absolute Wahrheit gab. Es war ein Kräfteringen darum, wer Herr im eigenen Hause sei, Ich, Über-Ich oder Es.
In seiner psychischen Selbstbiographie beschreibt Broch sein Zerrissensein zwischen der Bürde der Pflicht und dem Abgrund des Versagens, seiner Neigung zu einer öffentlich akzeptablen, repräsentativen Frau und seiner Liebe zur privaten, anziehenden Frau, zwischen Mutter und Dienstmädchen. Er wußte, daß eine Quelle seines Leidens am Gewissen in seiner Kindheit lag, im Mangel an mütterlicher Zuwendung, in der Eifersucht auf seinen Vater und seinen Bruder. Broch wunderte sich darüber, daß die Analyse nicht in der Lage sein sollte, "die eigentlichen Traumen aufzudecken und dieses ganze neurotische Gebäude, das eine auf die Spitze gestellte Pyramide ist, zum Zusammenbruch zu bringen". Mit dem Willen allein sei gegen eine Neurose nichts auszurichten.
Am Schluß seiner Selbstauskunft befiel ihn ein Schauer darüber, ob er sich mit diesen "privatesten Problemen in einer solchen Zeit" abgeben durfte. Er konnte das Nachdenken über sich selbst nur mit dem Hinweis rechtfertigen, daß "gerade in einer Zeit schärfster Anspannung und schärfster Forderungen an die persönliche Arbeitskraft ein seelisches Ordnungmachen notwendiger denn je geworden ist". Damit schnappte die Falle der Neurose wieder zu.
Es bleibt die Irritation über das Doppelporträt eines Schriftstellers, der sich aufgemacht hatte, den intellektuellen, wissenschaftlichen und künstlerischen Erfordernissen seiner Zeit gerecht zu werden. Man darf vielleicht festhalten, daß dem von ihm schmerzlich konstatierten Wertevakuum, dem er über Jahre hin in Studien zu einer Werttheorie zu begegnen hoffte, ein seelischer Mangel, eine "innerweltliche" Lücke zugrunde lag, die zu füllen ihm trotz seines Willens zur rückhaltlosen Selbsterkenntnis nicht gelingen konnte.
Hannah Arendt faßte die Konstitution Brochs in das Bild eines Dreiecks. Sie vermaß damit die Wirkungen von Kräften auf der Fläche. Denken und Handeln bedeuteten in ihren Augen, sich in der Wirklichkeit auszudehnen. Lebensgeschichte als psychologische Kategorie war in diesem Grundriß der Existenz nicht vorgesehen. Broch dagegen fand für sich das Bild einer auf den Kopf gestellten Pyramide. In eine Fläche gerückt, aus dem Blickwinkel des Außenstehenden betrachtet, sieht man ein Dreieck. Doch lebensgeschichtlich erfahren, fügen sich die Dreiecke zu einem Gebilde zusammen, dessen in die Seelenschichten ragende Spitze die Last des Lebens trägt.
Hermann Broch sprach über sich im Jargon einer Wissenschaft, deren Begriffe eine Innenwelt öffneten, die zu erforschen sie antrat. Der "Lebenskonflikt" füllte, so gesehen, eine seelische Lücke. Das "Arbeitsprogramm" erwuchs aus einem drückenden Mangel, den die "Psychische Selbstbiographie", um Einsichten besorgt, mit Worten umkreiste. Die besonderen Gründe für diese oder jene Arbeit, der er nachkam, für diese und jene Verpflichtung, die er auf sich nahm, verdeckten das grundlegende Motiv, im Dichten, Erkennen, Handeln von jenem Mangel erlöst zu werden. Man wird nach der Lektüre dieses Buches die Vermutung nicht los, hier habe einer auf weiten Strecken seines Schaffens ein lebenslanges Selbstgespräch geführt, auch wenn er glaubte, ein Gespräch mit anderen und für andere zu führen.
Hermann Broch: "Psychische Selbstbiographie". Herausgegeben von Paul Michael Lützeler. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999. 214 S., geb., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main