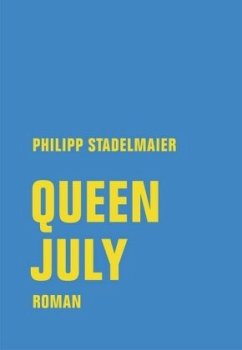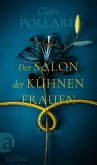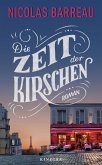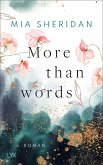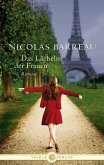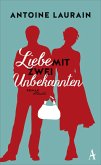Ein rekordheißer Sommer in Paris. Eine Badewanne voll von kaltem Wasser, darin: July, weißweintrinkend. Sie stellt Fragen, sie hört zu, sie kommentiert an den richtigen Stellen. Wo wäre Azizas Geschichte besser aufgehoben als bei ihr?Auf dem Fliesenboden neben der Wanne sitzend, nachts, erzählt Aziza jener July, einer Frau, die sie kaum kennt, von ihrem Aufwachsen in Paris - und ihrem Leben in Dschibuti. Seit Jahren versucht sie dort, ihr Pariser Leben und Lieben zu vergessen. Das fällt ihr nicht allzu schwer zwischen dem Job als Anästhesistin im chinesischen Krankenhaus, trockenen Gin Martinis mit dem attraktiven Kollegen aus Addis Abeba, der verwüsteten Hotel-Suite nach den Nächten mit den somalischen Khat-Schmugglerinnen und den Yacht-Touren mit einem Playboy aus Mosambik. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Strehler sich wieder meldet. Strehler, den Aziza noch aus der Schulzeit in Paris kennt, ihre erste echte Beziehung. Strehler, der sich ihr aus unerfindlichen Gründen immer wiederentzog, der sich damals dann plötzlich und unerwartet von ihr abwandte. Die rätselhaften Lücken in dieser Romanze haben aus Strehler ein Phantom gemacht, das Aziza die Leichtigkeit am Horn von Afrika vermiest. Und so verwickelt sich Aziza zwischen den Welten schon wieder in Schwärmereien, die nur July in ihrer Badewanne zu entwirren vermag.Der Roman »Queen July« ist wie ein französischer Film - ganz leicht erzählt und trotzdem von erstaunlicher Reflektiertheit.

Philipp Stadelmaiers Roman "Queen July"
Dass ein männlicher, deutschsprachiger Schriftsteller um die dreißig nicht allein von sich und seiner Lebenswelt erzählt, wie es in der Gegenwartsliteratur in den letzten Jahren in Mode gekommen ist (Stichwort: Autofiktion), ist zunächst einmal erfrischend. Für seinen Roman wählt Philipp Stadelmaier dieses Setting: ein Badezimmer im hochsommerlichen Paris, darin zwei Frauen, von denen die eine, July, in der Wanne Abkühlung sucht, während die andere, Aziza, ihr mit langem Atem von ihrem Leben in Dschibuti berichtet. Sie erzählt von ihrer Tätigkeit als Anästhesistin, ihren Affären mit Männern und Frauen, ihren Martinis und Eskapaden im örtlichen Sheraton. In der Hauptsache aber geht es um die in ihre wohlgeordnete Welt hereinbrechende Konfrontation mit der Jugendliebe aus Pariser Schulzeiten. Im Ton ist das Buch leicht, ja plauderhaft im besten Sinne, und es verzichtet auf badezimmerpsychologischen Jargon. "Queen July" ist ein weltläufiges Buch, das sich zudem auf der Höhe des kritischen Gegenwartsdiskurses bewegt: Immer wieder, mitunter nur beiläufig, werden Themen wie Gender, Ethnizität und Kolonialismus aufgegriffen.
Umso erstaunlicher wirkt es daher, dass es im Gespräch der beiden Frauen am Ende doch wieder nur um einen Mann geht; durch den sogenannten Bechdel-Test, ein kritisches Verfahren zur Identifikation stereotyper Weiblichkeitsbilder in Film und Literatur, würde der Roman vermutlich durchrasseln. Außerdem wird nicht wirklich überzeugend entwickelt, warum Aziza derart gefesselt ist von ihrer einstigen Jugendliebe. Der meist nur mit seinem Nachnamen genannte "Strehler" verkörpert das Klischeebild eines undurchsichtigen, verschlossenen Mannes, dessen Ausstrahlung ebenso faszinierend wie gefährlich ist. Dies verleitet Aziza an einer Stelle zu einem bizarren Vergleich: "Strehler, das war wie Terror, eine imaginäre Form des Terrors. Irgendwann taucht er mit seiner Kalaschnikow in deinem Leben auf und mäht alles nieder." Klar, es sind die Gedanken einer literarischen Figur, aber man darf sich schon fragen, worauf Philipp Stadelmaier, als Verfasser eines vielbeachteten Essays über "Terror und Meinung" (2016), eigentlich hinauswill: Geht es ihm um die drastische Beschreibung einer toxischen Mann-Frau-Beziehung? Oder um eine verstörend zeitgemäße Sprache der Liebe? Dies würde die Geschmacklosigkeit nicht aufheben, sie aber zumindest erklären.
sina
Philipp Stadelmaier: "Queen July". Roman.
Verbrecher Verlag,
Berlin 2019. 144 S.,
geb., 19,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Stark und eigenwillig findet Christian Metz Philipp Stadelmaiers Debüt. Der Roman, der als nachtlanges Gespräch zweier unabhängiger wie unverbindlicher Frauen im Paris von heute daherkommt, erzählt laut Metz von Liebesphantomen und dem Einfall des Terrors in die Blase der "Anywheres", jener Spezies von global agierenden Karrieristen, die überall und nirgends zuhause sind. Bemerkenswert scheint Metz, wie der Autor weit voneinander entfernte Orte und scharfe gesellschaftliche Analyse mit einer scheinbar mühelosen Gesprächssituation verbindet und dafür eine Sprache findet, die ambitioniert mit Rhythmuswechseln und Ellipsen arbeitet und dabei doch äußerst plastisch wirkt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH