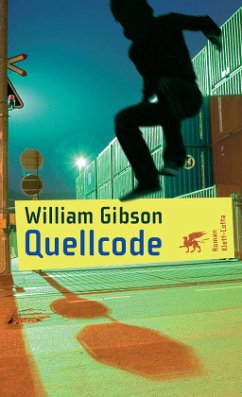Schillernde Figuren und eine spannungsgeladene Handlung verbindet William Gibson in seinem neunten Roman zu einer Innenschau unserer paranoiden, postmodernen Welt. Überall lauern im Quellcode unserer Gesellschaft Gefahren, die nicht mehr lokalisiert werden können. Die eigentlich Mächtigen bleiben virtuell.
Ein Gefühl der Bedrohung liegt über allem. Dem Großmeister der Science-Fiction ist eine faszinierende Diagnose unserer Gegenwart gelungen, indem er die Voraussetzungen für den globalen Terror spürbar macht.
Ein Gefühl der Bedrohung liegt über allem. Dem Großmeister der Science-Fiction ist eine faszinierende Diagnose unserer Gegenwart gelungen, indem er die Voraussetzungen für den globalen Terror spürbar macht.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
William Gibson, bis jetzt als Science-Fiction-Romancier bekannt, befindet sich in seinem neuen Roman auf der Höhe der Zeit, was das elektronische Equipment angeht, stellt Tobias Heyl interessiert fest. Begleitet man zu Anfang des Buches noch die hippe und mit Apple-Notebook und Motorola-Mobiltelefon bestens ausgestattete Hollis, die, wie sie glaubt, für ein entstehendes Magazin zur digitalen Kunst recherchieren soll, entwickelt sich die Geschichte zu einer rasanten Jagd dreier Parteien nach einem ganz bodenständigen verschwundenen Container, der 100 Millionen Dollar enthalten soll. Seit dem Anschlag auf das World-Trade-Center sind Verschwörungstheorien beliebt, Gibsons Plot aber wird auch "fortgeschrittene Paranoiker" erfreuen, da ist sich der Rezensent sicher. Und bei aller Einbindung ins digitale Netz und aller "Technologiebegeisterung", durch die immer wieder auch die Sehnsucht nach "Transzendenz" schimmert, ist auch "Quellcode" noch ein guter, alter, gedruckter Roman, stellt Heyl gar nicht unglücklich fest.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Beim Barte des Propheten: William Gibson hat ein ebenso schlaues wie langweiliges Buch über das Amerika des einundzwanzigsten Jahrhunderts geschrieben - eine Erzählskulptur aus lauter Versatzstücken.
Vermutlich sind heute weit mehr Wohnungen mit drahtlosen Internetzugängen ausgestattet als mit Balkonen. Wer das nicht weiß, ist Schlafmütze Milgrim, obschon er unentwegt schlaue Bücher liest: "Milgrim hatte bisher keine Ahnung gehabt, dass erstaunlich viele Leute solche Netzwerke in ihren Häusern und Wohnungen hatten oder dass sie so weit über die eigentlichen Wohnungen hinausreichten. Manche Netzwerke hießen nach ihren Eigentümern, andere einfach nur ,Default' oder ,Network', noch andere trugen Namen wie ,DarkHarvester' oder ,Doomsmith'. Milgrim hatte die Aufgabe, ein Fenster auf dem Bildschirm zu überwachen, das anzeigte, ob ein Netzwerk geschützt war oder nicht. War ein Netzwerk nicht geschützt und sandte ein ausreichend starkes Signal, fuhr Brown an die Seite und loggte sich mit seinem Computer ins Internet ein." Wir befinden uns kurz vor dem Finale von William Gibsons neustem Roman "Quellcode". Aber wie kann das sein? Spricht so der große Prophet des Cyberspace, der Schöpfer von "Neuromancer"?
Offenbar sind Cyberpunks zu abgehalfterten Netzschnorrern verkommen: Haste mal 'n W-Lan? Auch Hauptfigur Hollis Henry, ehemalige Rockröhre der Band The Curfew, was ihr immer noch alle Türen öffnet, loggt sich gerne in fremde Drahtlosnetze ein, selbst in amerikanischen Spitzenhotels. Was aber tut sie im Internet? Sie besucht die höchst subversiven Instanzen "Google" und "Wikipedia". Nahe an ihr Zielobjekt herangekommen, den undurchsichtigen Programmierfreak Bobby, zieht sich Hollis auf die Toilette zurück, um mit ihrem "PowerBook" über das unverschlüsselte Netz heimlich eine nicht weiter bedeutende Mail von ihrem Ex-Kollegen zu lesen. Möchte uns da jemand veralbern? Donnert es vom Web 5.0 herab: Ich habe euch den Cyberspace gebracht, und was tut ihr Trottel damit?
Die Handlung des Romans besteht aus drei Strängen. Der erste rankt sich um Hollis Henry, die soeben ihren Traumberuf Journalistin ergriffen hat. Der von Geheimnissen magisch angezogene Werbemagnat Hubertus Bigend, der zugleich das Verbindungsglied zum ebenfalls der Science-Fiction schon entrückten Vorgängerroman "Mustererkennung" darstellt, plant ein neues Magazin, "eine europäische Version von Wired". Für dieses soll Hollis einen großen Artikel über "Locative Art" verfassen, eine webbasierte Weiterentwicklung der Virtual Reality und zugleich Gibsons einzige prophetische Zutat: Mittels W-Lan-GPS-Helmen lassen sich demnach realitätsgetreu in den Raum einprogrammierte Objekte betrachten. Mit der eigentlichen Handlung hat das absolut nichts zu tun. Viel wichtiger ist, dass dabei das Peilsignal eines ominösen Containers geortet wird. Davon wiederum hat Bigend erfahren.
Der zweite Handlungsstrang erzählt von Tito. Seine in New York lebende kubanisch-chinesische Familie macht in organisierter Kriminalität. Für einen mysteriösen, ehemals mit dem Geheimdienst verbundenen Alten, dem die Familie einen Gefallen schuldet, führt Tito einen delikaten Auftrag durch. Zunächst hat er dafür zu sorgen, dass ein iPod in die Hände seiner Verfolger fällt. Die darauf befindlichen Daten sollen den falschen Eindruck erwecken, man habe den Aufenthaltsort des geheimnisvollen Containers noch nicht ausgemacht.
Überwacht wird Tito von dem vermutlich für die Regierung arbeitenden rechtslastigen Brown, der einen intelligenten Junkie, Milgrim, zur Mitarbeit erpresst. Das seltsame Gespann, Mittelpunkt des dritten Handlungsstrangs, verschlägt es schließlich wie alle anderen nach Kanada, weil der durch die Weltmeere kreuzende Container - die Black Box im Herzen des Romans - im Hafen von Vancouver eingelaufen ist. Wie sich herausstellt, sind in ihm hundert Millionen Dollar deponiert, die von den amerikanischen Milliardenbeträgen an Bargeld für die irakische Regierung im Juni 2004 abgezweigt wurden. Die übliche Geldwäsche sei in diesem Fall fehlgeschlagen, der Betrag ungewaschen zurückgekehrt. Nun habe die Kirche Klingelbeutel-Wäsche angeboten.
Browns Auftrag ist es, den Container zu schützen. Der Alte dagegen möchte aus Erbostheit über Irak-Kriegsgewinnler das Geld dauerhaft unbrauchbar machen: Dafür also der gesamte Aufwand. Hollis, die überall unmotiviert in die Handlung hineintrampelt, wird kurzerhand in das Vorhaben eingebunden. Es geschieht dann aber noch manches Unvorhergesehene während des großen Showdowns, das nicht verraten sein soll.
Programmatisch ist der Schurken-Chiasmus, bei dem die vermeintlichen Terroristen sich als Gutewichte erweisen, die mit Salzpatronen schießen, während die eigentlich Bösen uns gar nicht begegnen: Selbst Brown ist nur ein Befehlsempfänger, der sich um seinen gedungenen Knecht sorgt, wie um einen Hund. Zu allem Überfluss nämlich ist der Roman auch noch engagiert: Er prangert die Zustände im heutigen Amerika an, dem eigentlichen "Spook Country" (so der Originaltitel), während die Prä-Bush-Ära als Zeit erscheint, "als Amerika noch von Erwachsenen regiert wurde". Man weiß nun nicht, was langweiliger ist: die allesamt oberflächlichen Charaktere, der umständliche Stil des Beschreibungsfanatikers Gibson, wobei etwa dem Zähneputzen ganze Absätze gewidmet werden, oder ebendiese, seien wir ehrlich, vollkommen idiotische Handlung mit ihrem zeitkritischen Überbiss: "Habt ihr wirklich so große Angst vor Terroristen, dass ihr die Strukturen demontieren wollt, die Amerika zu dem gemacht haben, was es ist?" Fragt der Junkie.
Das Buch ist nicht nur mit ödester Standardterminologie aus der Computerwelt aufgeschwemmt (Websites, Server, Portale, Blogs, URL, WEP, Bluetooth, posten, booten und so fort), sondern auch mit einer solchen Fülle von Markennamen durchsetzt, dass man auf die Idee kommen könnte, es handelte sich um "Branded Entertainment", ein lieblos um die zu bewerbenden Produkte herumgewickeltes Geschehen. Warum etwa verliert Bigend auf den letzten Seiten schlicht das Interesse an der ganzen Angelegenheit und möchte stattdessen mit dem alten Curfew-Hit "Hard To Be One" auf dem chinesischen Werbemarkt aufschlagen?
Eingefleischte Gibson-Fans kann das freilich alles nicht schrecken. Sie betonen, wie gelungen hier die geisterhafte Atmosphäre eines Geistern nachjagenden Landes eingefangen ist und wie geschickt Gibson eine metareale Erzählskulptur aus Versatzstücken zu arrangieren vermag. Dass es sich um einen so erfahrenen wie geübten Erzähler handelt, steht außer Frage. Auch der langweiligste Gibson hat seine funkelnden Reflexionen. Titos Glaube an die Orishas der Santería-Religion etwa treibt die seltsamsten Blüten, und die verquere Kommunikation zwischen dem stets Befehle gebenden Agenten Brown, einer Lehrerfigur, und dem mit innerem Monolog reagierenden Milgrim, dem klugen Schüler, hat ihren Reiz. Anlässlich des Verputzens von Frankfurter Würstchen kommt Brown auf die Frankfurter Schule zu sprechen: "Laut Brown war das, was andere Leute political correctness nannten, in Wirklichkeit Kulturmarxismus und nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland in die Staaten gekommen, in den schlauen Köpfen jungen Professoren aus Frankfurt."
Viele, ja Hunderte von Einfällen Gibsons, ein ganzer Zettelkasten, sind in dem Roman verarbeitet, den Figuren in den Mund oder in die Gedanken gelegt, oft eher mühsam in die Handlung eingewoben: "Die Aufzugtüren gaben den Blick auf eine helle Holzfläche frei. Das platonische Ideal eines kleinen Orientteppichs wurde von der Decke aus daraufprojiziert: stilisierte Lichtschnörkel, die an etwas weniger stilisierte Schnörkel aus Wolle erinnerten. Ursprünglich dazu da, um zu verhindern, dass Allah beleidigt wurde, wie ihr mal jemand gesagt hatte." Mangelnde Intellektualität kann man dem Roman sicher nicht vorhalten, im Gegenteil. Allein: ein Erzählfluss entsteht dadurch noch nicht, vielmehr eine Aphorismensammlung, die mitunter prätentiös wirkt.
Der Erzähler, wenn er nicht abschweift, protokolliert als Chronist des Ephemeren jedes Detail: "Sie gingen eine Rampe hinauf zu einem überdachten Parkplatz. Ollie bezahlte mit einer Kreditkarte fürs Parken und führte sie dann zu seinem Auto." Es mag durchaus Strategie und nicht Unfall sein, den Leser einerseits in zahllose Digressionsfallen zu locken und andererseits immer wieder inmitten der Banalitäten des Alltags auszusetzen. Vielleicht soll man eben nicht gebannt einem abgeschlossenen Geschehen folgen. Vielleicht soll man den brüchigen Figuren misstrauen, die nicht mehr poetisch idealisierte Bewohner einer Gegenwelt sind, sondern Avatare von Avataren, zusammenprogrammiert aus Klischees und Diskursabfällen. Vielleicht muss man sich aber auch einfach mit dem langen Bart des Propheten begnügen, wenn einmal der Quellcode versiegt ist.
OLIVER JUNGEN
William Gibson: "Quellcode". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Stefanie Schaeffler. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2008. 448 S., geb., 22,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main