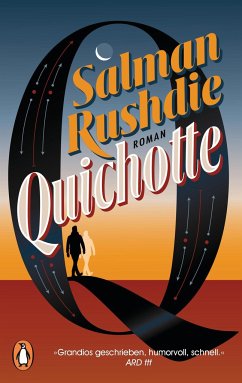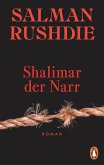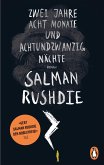Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Ismael Smile ist ein Reisender, der besessen ist von der »unwirklichen Wirklichkeit« des Fernsehens. Er will das Herz der Königin aller Talkshows erobern und begibt sich auf eine Reise quer durch Amerika, um sich ihrer als würdig zu erweisen. Auf dem Beifahrersitz, Sancho, der Sohn, den er sich immer gewünscht hat, aber niemals bekam.
Auf grandiose versetzt Bestsellerautor Salman Rushdie die Abenteuer des klassischen tragischen Helden Quichotte in unser Zeitalter des »Alles ist möglich«.
»Mit Cervantes durch die USA von heute: eine witzige und scharfsinnige Road-Novel.« DIE ZEIT
Ismael Smile ist ein Reisender, der besessen ist von der »unwirklichen Wirklichkeit« des Fernsehens. Er will das Herz der Königin aller Talkshows erobern und begibt sich auf eine Reise quer durch Amerika, um sich ihrer als würdig zu erweisen. Auf dem Beifahrersitz, Sancho, der Sohn, den er sich immer gewünscht hat, aber niemals bekam.
Auf grandiose versetzt Bestsellerautor Salman Rushdie die Abenteuer des klassischen tragischen Helden Quichotte in unser Zeitalter des »Alles ist möglich«.
»Mit Cervantes durch die USA von heute: eine witzige und scharfsinnige Road-Novel.« DIE ZEIT
»Salman Rushdie ist einer der großartigsten Erzähler der Gegenwart.« stern.de

Er hat's mit dem Klassiker: Salman Rushdie wagt mit seinem neuen Roman eine moderne Version von "Don Quijote" - und gewinnt.
Von Andreas Platthaus
Müßiger Leser! Du kannst mir aufs Wort glauben, dass ich selbst gerne wollte, dieses Buch, ein Kind unserer Zeit, wäre das schönste, das trefflichste und das klügste, das sich nur erdenken ließe. Allein, wie sollte es das sein, nachdem wir doch schon die Romane von Doderer, Virginia Woolf und Joyce gelesen haben, von Proust und Kafka, Flaubert, Melville, Stendhal, Austen, Goethe und jenem Autor, der ganz am Beginn dessen steht, was wir Roman nennen - von Cervantes? Nein, das Buch, um das es hier geht, ist nicht das schönste, trefflichste und klügste seiner Art. Letzteres schon deshalb nicht, weil es den Titel "Quichotte" trägt, also den Vergleich mit dem mehr als vierhundert Jahre alten Ursprungswerk seiner Gattung, eben dem "Don Quijote" des Cervantes, mutwillig herausfordert. Der Autor eines solchen Romans muss größenwahnsinnig sein. Oder Salman Rushdie.
Der englische Schriftsteller, geboren 1947 in Bombay, zwei Monate, bevor seine indische Heimat unabhängig wurde, und schon deshalb ein Weltbürger, seit mittlerweile fast zwanzig Jahren wohnhaft in New York, ist weltberühmt. Leider weniger für seine Literatur als für das Todesurteil, das der iranische Staatschef Ajatollah Chomeini 1989 wegen Rushdies Roman "Die satanischen Verse" über den Autor verhängte. Die exorbitanten literarischen Qualitäten dieses Buchs verblassten gegenüber dem grellen Skandalon der Fatwa. Wie auch Rushdies noch besserer Roman "Mitternachtskinder" von 1981 und sämtliche weitere Werke, die er später schrieb, darunter ein so brillantes Buch wie die 2012 erschienene Autobiographie "Joseph Anton".
Und so wird es auch "Quichotte" gehen - egal, ob es Rushdie damit gelingen sollte, am kommenden Montag, 38 Jahre nach den "Mitternachtskindern", noch einmal den Bookerpreis, die wichtigste britische Literaturauszeichnung zu gewinnen. Der Schriftsteller weiß das, und das Wissen um die Überschattung des ganzen Werks durch sein persönliches Drama sowie die Erkenntnis, dass es nichts zu verlieren gibt, haben ihn diesmal rücksichtslos gegen sich selbst gemacht. Maßlos in seinen Ansprüchen. Und furchtlos.
Furchtlos, denn wie hätte er es sonst wagen können, sich literarisch mit einem der Größten zu messen? Seinen Helden Quichotte, dessen Namensschreibweise sich Jules Massenets Opernadaption des Cervantes-Romans verdankt, führt Rushdie so ein: "Einst lebte an verschiedenen Adressen quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika ein Reisender indischen Ursprungs, fortgeschrittenen Alters und mit schwindenden geistigen Kräften, der angesichts seiner Liebe zum geistlosen Fernsehen viel zu viel Lebenszeit im gelben Licht von geschmacklosen Motelzimmern verbracht hatte, wo er es bis zum Exzess schaute, und der als Folge eine absonderliche Form des Hirnschadens davongetragen hatte." Die schon hier, im ersten Satz des Romans, sichtbar miteinander verwobenen Stilregister - Archaismen neben Profanitäten, Märchenton neben Realismus, Komik neben Tragik - ergeben einen Cantus firmus des Ironischen, der das ganze Buch prägen wird. Der Ritter von der traurigen Gestalt wird zum Angestellten in traurigem Zustand. Und die spanische Mancha, diese Tabula rasa von einem Handlungsort in "Don Quichotte", ist mit dem Niemandsland der amerikanischen Provinz, das Quichotte durchreist, perfekt neu besetzt.
Auch wenn es bei Rushdie keinen expliziten Kampf gegen Windmühlen gibt, weil das ganze Buch ja schon selbst ein solcher ist: sinnloses Bemühen, aber darin geradezu romantisch groß, ist es kein Kunststück, die Bezüge von "Quichotte" zu "Don Quijote" zu benennen. Das in Amerika heute allgegenwärtige Fernsehen entspricht den geistbenebelnden Ritterromanen bei Cervantes. Rushdies Äquivalent für Dulcinea von Toboso findet sich in der höchst realen und selbstsarkastisch benannten Starschauspielerin Salma R. - auch sie, wie das ganze Hauptpersonal, indischstämmig -, für die Quichotte ebenso hoffnungslos entbrannt ist wie sein literarisches Vorbild ins Phantasma von dessen Dame. Quichotte hat zudem wie Quijote einen Begleiter namens Sancho, der allerdings physiognomisch das genaue Gegenteil seines spanischen Namensvetters ist - und eine reine Kopfgeburt: "Er selbst sei eine Art Geist, rief er sich in Erinnerung. Er war eine parthenogenetisch gezeugte, nicht registrierte Person, keine Geburtsurkunde oder andere Spuren von ihm in irgendeiner Kartei. Zwar war er hier, aber er sollte es nicht sein."
Wie man hier lesen kann, weiß diese Figur um ihr Schicksal als Figur. Damit ist sie nicht allein. Rushdie betreibt konsequent dasselbe Vexierspiel mit der Durchdringung von Literatur und Leben wie Cervantes. Was aber die Maßlosigkeit der Ansprüche von Rushdie ausmacht, ist die Steigerung dieser Metafiktionalität. Der zweite Hauptstrang des Romans erzählt die Geschichte dessen Verfassers - "ein in New York lebender Schriftsteller indischen Ursprungs", der aber nicht Salman Rushdie selbst ist, sondern ein Autor des Buchs im Buch, der den nom de plume Sam DuChamp trägt und vom eigentlichen auktorialen Erzähler als "Bruder" tituliert wird. Seine Schaffens- und Familienkrisen (die Verwandtschaft besteht aus "Schwester", "Tochter" und "Sohn") treiben wiederum die von DuChamp erdachten Figuren voran, so sehr, dass es irgendwann heißt: "Nun sind Quichotte und ich nicht mehr zwei verschiedene Wesen, das eine kreiert und das andere kreierend, dachte er. Nun bin ich Teil von ihm, ebenso wie er Teil von mir ist." Und genauso verhält es sich denn auch in Rushdies "Quichotte". DuChamp ist tatsächlich ein Bruder, einer im Geiste seines Erfinders. Und der "Sohn" heißt übrigens Marcel.
Die gerade zitierte kurze Passage lässt ein Übertragungsproblem aufscheinen, das Sabine Herting, Rushdies Übersetzerin seit "Golden House" (2017), häufiger hat: zu große lautmalerische Nähe zum englischen Original. "Kreiert" statt "geschaffen" für "created" nimmt der Stelle ihren biblischen Anklang, wobei ganz generell eine weitere Herausforderung für die deutsche Fassung im literarischen Anspielungsreichtum von "Quichotte" bestand, der weit über "Don Quijote" hinausgeht und etwa auch - in einer Nachbemerkung ausgewiesen - Ionescos Drama "Die Nashörner" und Arthur C. Clarkes Science-Fiction-Erzählung "Die neun Milliarden Namen Gottes" oder - unausgewiesen - L. Frank Baums "Zauberer von Oz" und Collodis "Pinocchio" (aber in der Disney-Filmversion) umfasst. Rushdie hat's mit den Klassikern, aber die deutsche Fassung hat leider nicht immer den hierzulande eingeführten Tonfall dazu parat.
Der Stoff von "Quichotte" jedoch ist konsequent modern, man könnte sogar sagen: tagesaktuell. Nicht nur, weil Rushdie seine Salma R. einmal im Fernsehen als Geheimdienstfrau Salma C. auftreten lässt, in einer Serie, "die als Reaktion auf tatsächliche Ereignisse einen gänzlich imaginären Regierungschef einführte, der von Cable News besessen war, der der Basis weißer Rassisten schmeichelte, der mit Salma C.s Vorgänger Golf gespielt hatte und mit ihm Umkleide-Scheiß über Frauen gequatscht hatte". Die Quest des Handlungsreisenden Quichotte wird verquickt mit der dubiosen Erfolgsgeschichte eines Cousins, Dr. R. K. Smile, der sein Vermögen mit dem Verkauf eines von ihm hergestellten Opioids gemacht hat. Wie Rushdie hier bis in kleinste Detail den realen Skandal um das abhängig machende Medikament Oxycontin in seine Romanwelt einbezieht, ist meisterhaft. Als Auslieferer des Mittels bekommt Quichotte endlich die Chance, die angebetete Salma R. persönlich kennenzulernen, und diesen äußerst wirklichkeitsnahen Teil der Geschichte hat Rushdie kürzlich für einen Separatabdruck im "New Yorker" aus dem Roman herauspräpariert, der, ganz nebenbei, eine berückende short story darstellt. Die pikareske Tradition von "Quichotte", vom "Bruder" spät im Buch gegenüber dem "Sohn" eigens erläutert, verlangt nach derartigem episodischen Erzählen. Doch zugleich macht Rushdie aus seinem Roman ein Epos in der Tradition von Road-Novels, die uns quer durch die Vereinigten Staaten mitnehmen, und von Apokalypsen, die zum Finale die ganze Menschheit in den Abgrund zu reißen drohen. Doch wie passend: Die Schreibstube des Romanciers wird zum Rettungsanker.
Das ist ein schöner Schluss, auch wenn es nicht das schönste, nicht das trefflichste und klügste Buch sein kann. Aber einige der schönsten, trefflichsten, klügsten Bücher haben es inspiriert. "Gute Kenntnisse der Klassiker", sagt Quichotte bei Rushdie einmal zu Sancho, "verraten den gebildeten Mann." Das ist ebenso ernst zu nehmen wie die Äußerung eines anderen alten Narren: "Soviel ich davon verstehe", sagt Don Quijote bei Cervantes zu Beginn des zweiten Teils seiner Abenteuer zum Bakkalaureus, "muss man, um Geschichten und Bücher welcher Art auch immer zu schreiben, in der Tat einen großen Verstand und ein reifes Urteil besitzen. Mit Anmut zu scherzen und witzig zu schreiben, ist nur bedeutenden Köpfen gegeben." Solchen wie Salman Rushdie.
Salman Rushdie: "Quichotte". Roman.
Aus dem Englischen von Sabine Herting. Verlag C. Bertelsmann, München 2019. 459 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Für Johannes Kaiser ist Salman Rushdies neues Buch sein bester Roman seit langem. Dass der Autor seine literarischen Mittel (Satire, Parodie, Persiflage) im Text selbst benennt, erleichtert Kaiser die Arbeit. Wie Rushdie in seiner Geschichte um einen pensionierten, indischstämmigen Pharmavertreter, der ruhelos die Welt durch das Fernsehen wahrnimmt, sich in eine TV-Moderatorin verliebt und auf der Suche nach ihr die USA mit dem Autor durchquert, Fakten, Fiktion und Autobiografisches vermischt, scheint Kaiser meisterlich. Die im Buch verhandelten aktuellen Themen Cyberkrieg, Rassismus, Fake-News sowie die Dauerbrenner Liebe, Vater-Sohn- und Geschwisterkonflikte, ergeben laut Kaiser zudem ein wenig schmeichelhaftes Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft - und atemberaubende Lektüre sowieso.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH