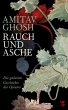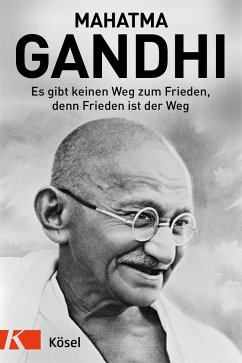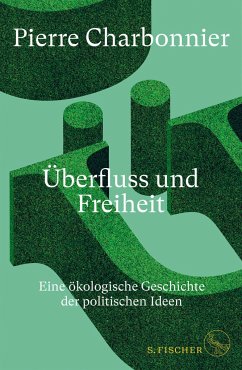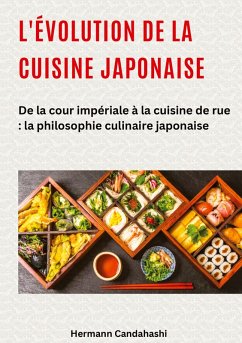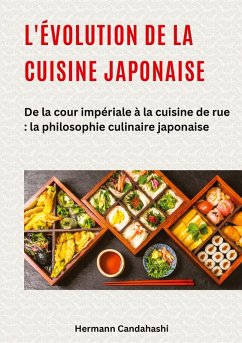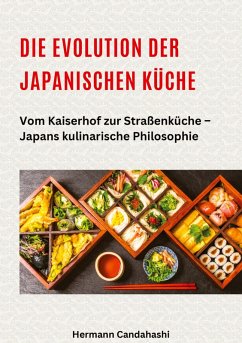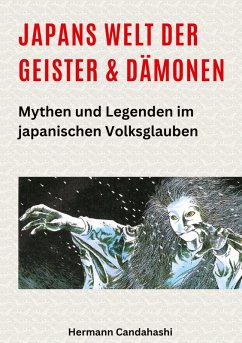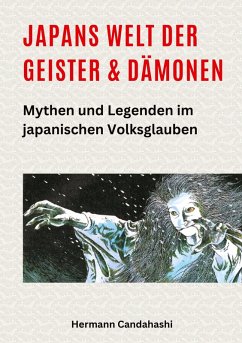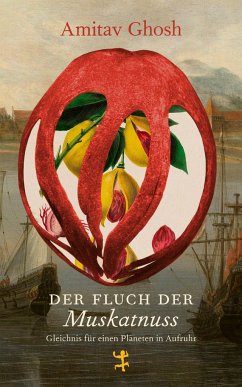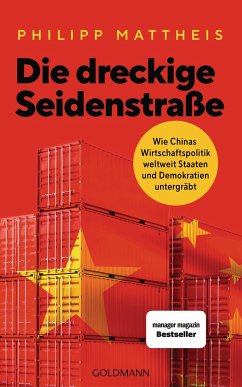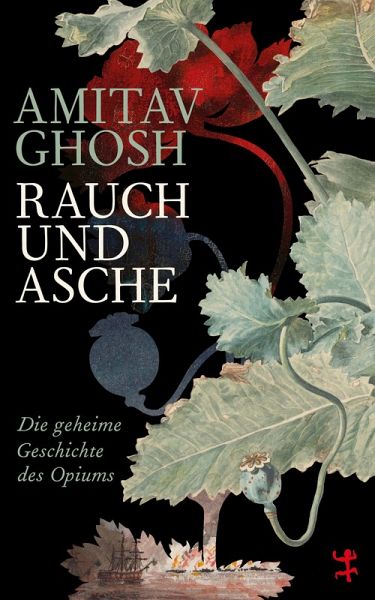
Rauch und Asche
Die geheime Geschichte des Opiums
Übersetzung: Lutosch, Heide

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal.Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege u...
In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal.
Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel.
Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel.