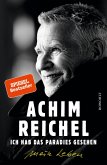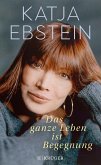"Eines der schönsten Bücher über Beethoven." René Aguigah, Das Blaue Sofa
Ludwig van Beethovens neun Sinfonien sind Meilensteine der Musikgeschichte: Nie zuvor hat reine Instrumentalmusik einen so vielschichtigen, klanggewaltigen Kosmos erschaffen.
Karl-Heinz Ott lädt uns ein auf eine literarisch-philosophisch inspirierte Reise, spürt der Wirkung der Sinfonien durch die Jahrhunderte nach, erzählt von dem Rausch, in den sie uns versetzen, und fragt: Warum entfaltet diese Musik nach wie vor einen solchen Sog? Für Kenner wie Einsteiger gleichermaßen ein Gewinn.
Ludwig van Beethovens neun Sinfonien sind Meilensteine der Musikgeschichte: Nie zuvor hat reine Instrumentalmusik einen so vielschichtigen, klanggewaltigen Kosmos erschaffen.
Karl-Heinz Ott lädt uns ein auf eine literarisch-philosophisch inspirierte Reise, spürt der Wirkung der Sinfonien durch die Jahrhunderte nach, erzählt von dem Rausch, in den sie uns versetzen, und fragt: Warum entfaltet diese Musik nach wie vor einen solchen Sog? Für Kenner wie Einsteiger gleichermaßen ein Gewinn.
Heiterer Rausch,
feine Stille
Karl-Heinz Ott führt durch
Beethovens sinfonische Welt
Es ist ein unterhaltsam geschriebenes Bildungsbüchlein, in dem es nicht nur um den Komponisten Ludwig van Beethoven und die detaillierte Beschreibung seiner neun Sinfonien geht, sondern um viel mehr. Karl-Heinz Ott, Autor von Romanen und Sachbüchern, zuletzt über Georg Friedrich Händel, fördert viel Wissenswertes zutage, manchmal auch recht lapidar hingeworfenes Schulwissen, dann wieder Tiefergehendes für Kenner und Neugierige. Dabei geriert er sich selten als Besserwisser, sondern ködert den Leser meist mit schlauem Geplauder über die historischen und philosophischen Hintergründe der tiefgreifenden Umbrüche in der Ästhetik der Wiener Klassik. Was den Autor von einem strengen Musikwissenschaftler unterscheidet, ist die publikumswirksame Mischung aus Anekdote und Sachunterricht, vor allem aber der publizistisch immer ergiebige Kurzschluss von Schöpfer und Werk.
Dabei wirft Ott die Angel manchmal sehr weit aus, sodass der Köder auch mal durchs Trübe gleitet. Dass man etwa den Beethoven-Darstellungen in Öl entnehmen soll, dass „Beethoven nicht die Freundlichkeit in Person gewesen“ sei, ist dummes Zeug. Die meisten Porträts wurde erst nach seinem Tod gemalt, und wohl in keinem Fall in dokumentarischer Absicht, sondern bereits umfassend kontaminiert mit sentimentalen Künstler-Klischees. Beethoven war nicht im Servicebereich tätig, sondern auf dem Gebiet der Aufklärung und Aufrüttelung der Menschheit bei gleichzeitiger Verschönerung der Welt. Das kann nur gelingen, wenn man zur Menschheit eine gesunde Distanz behauptet.
Wie sehr man einem Künstler Gerechtigkeit und Menschlichkeit widerfahren lässt, wenn man sein Werk strikt von seiner Person trennt, zeigen die – leider nur lapidar hingeworfenen – Beispiele groben Missbrauchs der Musik Beethovens. Am schlimmsten hat es wohl die Neunte getroffen, von der im allgemeinen Bewusstsein oft nur noch das gesungene Chorende präsent ist. Bernstein dichtete es nach dem Mauerfall zum Freiheitsliedchen um, und bevor es Europahymne wurde, schmückte es auch schon als Nationalhymne den Apartheidstaat Rhodesien, musste dem ein oder anderen Popschlager auf die Sprünge helfen und auch sonst allerlei mit sich machen lassen, wovon ja immer auch ein bisschen auf den Komponisten abfärbt. Staatspräsident François Mitterrand, der große Esoteriker, ließ die „Ode an die Freude“ spielen, während er aufs Pantheon zuschritt, desgleichen Emmanuel Macron, dessen Weg über den Hof des Louvre führte, wo Mitterrand seine symbolübersättigte Glaspyramide hinpflanzen ließ.
Und natürlich auch der: Hitler ließ sich die Neunte, allerdings die komplette, zum Geburtstag vorspielen. Der Weg zum Führerkitsch war nicht weit, den der Musikwissenschaftler Arnold Schering in seiner hermeneutischen Aufladung der Fünften Symphonie auslebte. Das war selbst eingefleischten Nazis zuviel und man kann kaum glauben, dass er selber von dem überzeugt war, was er dem geneigten Publikum zu hören aufgab: Beethovens Fünfte sei das Bild eines Volkes, das „in kindlicher Demut zu Gott betet, dass er ihm einen Retter, einen Führer aus Schmach und Elend sende“. Für den beschwingten Einstieg in den zweiten Satz der Fünften hat er dafür sogar ein passendes Gebet gedichtet.
Was heute absurd anmutet, liegt dennoch im Rahmen dessen, was all jene öffentlichen und privaten Deuter jener Musik angetan haben und weiter antun, die textlos ist und damit schon für viele Zeitgenossen Beethovens inhaltsleer, bedeutungslos, schließlich sinnlos. Die Versuche, das vermeintliche Manko auszugleichen, beginnen mit der Entstehung der von Richard Wagner so genannten absoluten Musik. Ob als Parodien oder pathetische Hohlgebirge – es ist alles dabei, was man sich denken kann, und auch alles, worauf man nicht gekommen ist. Das Bedürfnis nach begrifflich fassbarem Sinn war groß, auch noch nach dem Tod Beethovens liefen Menschen aus Konzerten, in denen seine Musik gespielt wurde. Sie fühlten sich angegriffen, waren irritiert.
Ott bringt anschauliche Beispiele aus der Literatur, etwa eine Szene aus dem Roman „Howards End“, auf welch’ unterschiedliche Arten man Musik erfahren kann. Auch die Antagonismen zwischen Rameau und Rousseau sind hier wichtig, vor allem deren Fortsetzung bei Tolstoi. Auch in den Einzeldarstellungen der Sinfonien legt Ott großen Wert darauf, unterschiedliche Sichtweisen und Deutungen darzustellen. Die sind nicht alle für sich bemerkenswert, befördern aber die fröhliche dialektische Grundlaune enorm.
HELMUT MAURÓ
Karl-Heinz Ott: Rausch und Stille. Beethovens Sinfonien. Verlag Hoffman und Campe, Hamburg 2019. 285 Seiten, 24 Euro.
Distanz zur Menschheit
hilft beim Verschönern
der Welt
Die Darstellung verschiedener
Sichtweisen fördert die
dialektische Grundlaune
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
feine Stille
Karl-Heinz Ott führt durch
Beethovens sinfonische Welt
Es ist ein unterhaltsam geschriebenes Bildungsbüchlein, in dem es nicht nur um den Komponisten Ludwig van Beethoven und die detaillierte Beschreibung seiner neun Sinfonien geht, sondern um viel mehr. Karl-Heinz Ott, Autor von Romanen und Sachbüchern, zuletzt über Georg Friedrich Händel, fördert viel Wissenswertes zutage, manchmal auch recht lapidar hingeworfenes Schulwissen, dann wieder Tiefergehendes für Kenner und Neugierige. Dabei geriert er sich selten als Besserwisser, sondern ködert den Leser meist mit schlauem Geplauder über die historischen und philosophischen Hintergründe der tiefgreifenden Umbrüche in der Ästhetik der Wiener Klassik. Was den Autor von einem strengen Musikwissenschaftler unterscheidet, ist die publikumswirksame Mischung aus Anekdote und Sachunterricht, vor allem aber der publizistisch immer ergiebige Kurzschluss von Schöpfer und Werk.
Dabei wirft Ott die Angel manchmal sehr weit aus, sodass der Köder auch mal durchs Trübe gleitet. Dass man etwa den Beethoven-Darstellungen in Öl entnehmen soll, dass „Beethoven nicht die Freundlichkeit in Person gewesen“ sei, ist dummes Zeug. Die meisten Porträts wurde erst nach seinem Tod gemalt, und wohl in keinem Fall in dokumentarischer Absicht, sondern bereits umfassend kontaminiert mit sentimentalen Künstler-Klischees. Beethoven war nicht im Servicebereich tätig, sondern auf dem Gebiet der Aufklärung und Aufrüttelung der Menschheit bei gleichzeitiger Verschönerung der Welt. Das kann nur gelingen, wenn man zur Menschheit eine gesunde Distanz behauptet.
Wie sehr man einem Künstler Gerechtigkeit und Menschlichkeit widerfahren lässt, wenn man sein Werk strikt von seiner Person trennt, zeigen die – leider nur lapidar hingeworfenen – Beispiele groben Missbrauchs der Musik Beethovens. Am schlimmsten hat es wohl die Neunte getroffen, von der im allgemeinen Bewusstsein oft nur noch das gesungene Chorende präsent ist. Bernstein dichtete es nach dem Mauerfall zum Freiheitsliedchen um, und bevor es Europahymne wurde, schmückte es auch schon als Nationalhymne den Apartheidstaat Rhodesien, musste dem ein oder anderen Popschlager auf die Sprünge helfen und auch sonst allerlei mit sich machen lassen, wovon ja immer auch ein bisschen auf den Komponisten abfärbt. Staatspräsident François Mitterrand, der große Esoteriker, ließ die „Ode an die Freude“ spielen, während er aufs Pantheon zuschritt, desgleichen Emmanuel Macron, dessen Weg über den Hof des Louvre führte, wo Mitterrand seine symbolübersättigte Glaspyramide hinpflanzen ließ.
Und natürlich auch der: Hitler ließ sich die Neunte, allerdings die komplette, zum Geburtstag vorspielen. Der Weg zum Führerkitsch war nicht weit, den der Musikwissenschaftler Arnold Schering in seiner hermeneutischen Aufladung der Fünften Symphonie auslebte. Das war selbst eingefleischten Nazis zuviel und man kann kaum glauben, dass er selber von dem überzeugt war, was er dem geneigten Publikum zu hören aufgab: Beethovens Fünfte sei das Bild eines Volkes, das „in kindlicher Demut zu Gott betet, dass er ihm einen Retter, einen Führer aus Schmach und Elend sende“. Für den beschwingten Einstieg in den zweiten Satz der Fünften hat er dafür sogar ein passendes Gebet gedichtet.
Was heute absurd anmutet, liegt dennoch im Rahmen dessen, was all jene öffentlichen und privaten Deuter jener Musik angetan haben und weiter antun, die textlos ist und damit schon für viele Zeitgenossen Beethovens inhaltsleer, bedeutungslos, schließlich sinnlos. Die Versuche, das vermeintliche Manko auszugleichen, beginnen mit der Entstehung der von Richard Wagner so genannten absoluten Musik. Ob als Parodien oder pathetische Hohlgebirge – es ist alles dabei, was man sich denken kann, und auch alles, worauf man nicht gekommen ist. Das Bedürfnis nach begrifflich fassbarem Sinn war groß, auch noch nach dem Tod Beethovens liefen Menschen aus Konzerten, in denen seine Musik gespielt wurde. Sie fühlten sich angegriffen, waren irritiert.
Ott bringt anschauliche Beispiele aus der Literatur, etwa eine Szene aus dem Roman „Howards End“, auf welch’ unterschiedliche Arten man Musik erfahren kann. Auch die Antagonismen zwischen Rameau und Rousseau sind hier wichtig, vor allem deren Fortsetzung bei Tolstoi. Auch in den Einzeldarstellungen der Sinfonien legt Ott großen Wert darauf, unterschiedliche Sichtweisen und Deutungen darzustellen. Die sind nicht alle für sich bemerkenswert, befördern aber die fröhliche dialektische Grundlaune enorm.
HELMUT MAURÓ
Karl-Heinz Ott: Rausch und Stille. Beethovens Sinfonien. Verlag Hoffman und Campe, Hamburg 2019. 285 Seiten, 24 Euro.
Distanz zur Menschheit
hilft beim Verschönern
der Welt
Die Darstellung verschiedener
Sichtweisen fördert die
dialektische Grundlaune
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»Eines der schönsten Bücher über Beethoven.« René Aguigah Das Blaue Sofa 20191018