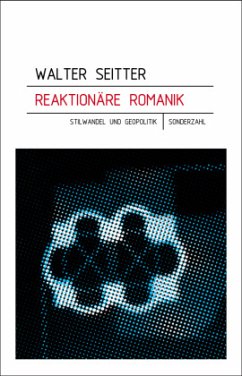Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich der Philosoph Walter Seitter mit Phänomenen der westeuropäisch-mittelalterlichen Kultur. Damals begann er auch verstärkt, Bau- und Bildwerke aus dem 13. Jahrhundert zu besuchen und einige davon zu beschreiben, insbesondere solche, die mehr oder weniger entschieden am "romanischen" Stil festgehalten haben, obwohl der "gotische" Stil seinerzeit schon längst über Frankreich hinaus bekannt war.
Die vier Bau- und Bildwerke, die Walter Seitter zwischen 1990 und 2010 besucht hat und in seinem neuen Buch vorführt, gehören unterschiedlichen Landschaften, aber auch sehr unterschiedlichen Gattungen und Rängen an: Da ist die niederösterreichische Landkirche Schöngrabern mit ihrer reichen, ja einzigartigen Skulpturenapplikation an der mächtigen Ostapsis; sodann das von Kaiser Friedrich II. persönlich in Auftrag gegebene und wohl auch maßgeblich bestimmte Schloss Castel der Monte in Apulien; der Dom von Naumburg, vor allem sein Stifterchor im Westen; schließlich das, was von der romanischen Stephanskirche in Wien noch übriggeblieben ist.
Diese ganz persönlichen Begegnungen und Begehungen führen auch dazu, dass Walter Seitter jedes Monument als ein Individuum betrachtet, das in seine Geschichte eingebettet ist, zu der auch die "Nachgeschichte" gehört - also auch all jene Veränderungen, die im Laufe der Zeit den Bauwerken "passiert" sind.
Die geographische Streuung dieser vier Monumente zeigt schon, dass sich das Phänomen der "verspäteten Romanik" nicht auf eine einzige Region beschränkt, auch nicht auf den Ostrand des Heiligen Römischen Reiches. So hat Walter Seitter auch seine Erfahrungen mit dem Mittelalter in Griechenland und Zypern in dieses Buch einfließen lassen. - Sein Resümee im Sinne einer Geopolitik lautet daher: "Die Kunstgeschichte kann es sich heute nicht mehr leisten, die Kunstgeographie zu verdrängen oder nur so halb bewusst mitzuschleppen."
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Die vier Bau- und Bildwerke, die Walter Seitter zwischen 1990 und 2010 besucht hat und in seinem neuen Buch vorführt, gehören unterschiedlichen Landschaften, aber auch sehr unterschiedlichen Gattungen und Rängen an: Da ist die niederösterreichische Landkirche Schöngrabern mit ihrer reichen, ja einzigartigen Skulpturenapplikation an der mächtigen Ostapsis; sodann das von Kaiser Friedrich II. persönlich in Auftrag gegebene und wohl auch maßgeblich bestimmte Schloss Castel der Monte in Apulien; der Dom von Naumburg, vor allem sein Stifterchor im Westen; schließlich das, was von der romanischen Stephanskirche in Wien noch übriggeblieben ist.
Diese ganz persönlichen Begegnungen und Begehungen führen auch dazu, dass Walter Seitter jedes Monument als ein Individuum betrachtet, das in seine Geschichte eingebettet ist, zu der auch die "Nachgeschichte" gehört - also auch all jene Veränderungen, die im Laufe der Zeit den Bauwerken "passiert" sind.
Die geographische Streuung dieser vier Monumente zeigt schon, dass sich das Phänomen der "verspäteten Romanik" nicht auf eine einzige Region beschränkt, auch nicht auf den Ostrand des Heiligen Römischen Reiches. So hat Walter Seitter auch seine Erfahrungen mit dem Mittelalter in Griechenland und Zypern in dieses Buch einfließen lassen. - Sein Resümee im Sinne einer Geopolitik lautet daher: "Die Kunstgeschichte kann es sich heute nicht mehr leisten, die Kunstgeographie zu verdrängen oder nur so halb bewusst mitzuschleppen."
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Walter Seitter verspricht in seinem Buch "Reaktionäre Romanik" fünf Essays über den architektonischen und kulturellen Wandel von der Romanik zur Gotik, keine strengen wissenschaftlichen Abhandlungen sollen sie sein, sondern nur seine "eigene Meinung", berichtet Johannes Fried. Aber auch Meinungen müssen gewissen Ansprüchen genügen, findet der Rezensent, und Seitters seien "sachlich unzureichend und analytisch unangemessen". Friedrichs II. Castel del Monte unterstellt der Autor beispielsweise eine "rittermönchische Dynamik", halb Festung, halb Kloster, dabei ist in Wahrheit weder Militärisches noch Sakrales zu entdecken, wundert sich der Rezensent. Wer sich mit dem mittelalterlichen Stiftergedenken auskennt, wird sich auch mit Seitters anschließender Interpretation der Figuren im Naumburger Westchor nicht anfreunden können, warnt Fried. Wenn der Autor nur schildern möchte, was er sieht, sollte er mit verallgemeinernden Aussagen über eine "reaktionäre Romanik" vorsichtiger sein, findet Fried, ein erster Eindruck ersetze nun mal keine umfangreiche Forschung. Mit einem aktuellen Kunstreiseführer in der Hand reist es sich immer noch besser, vermutet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH