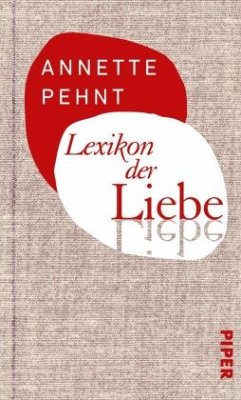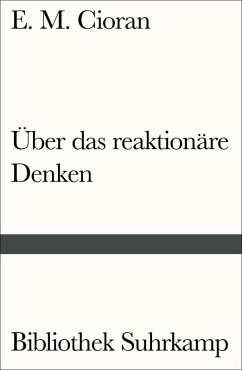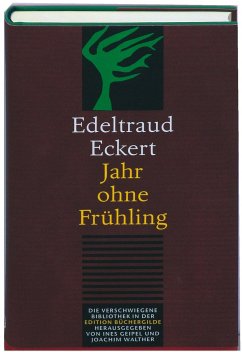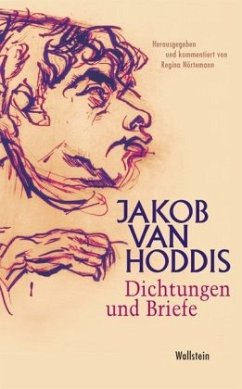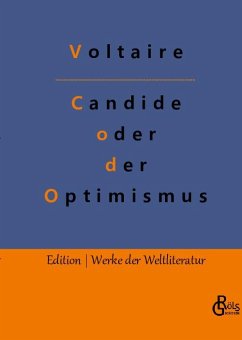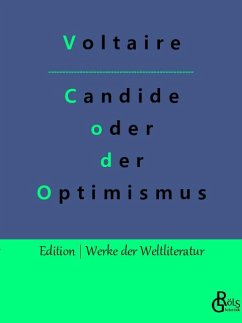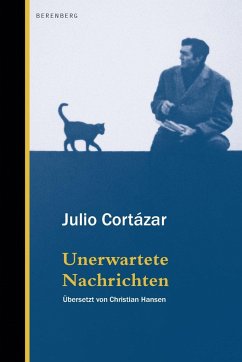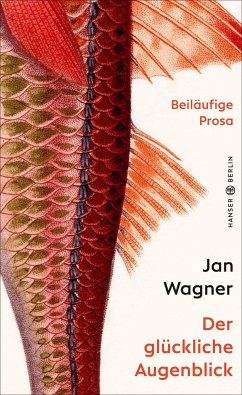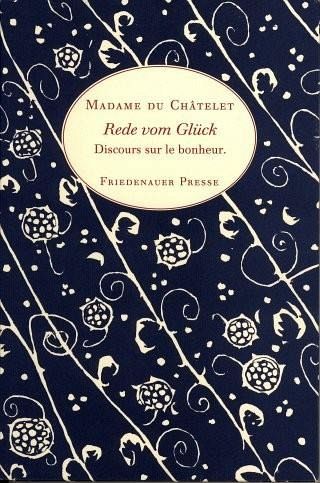
Rede vom Glück
Discours sur le bonheur
Herausgegeben: Roebling, Iris;Übersetzung: Roebling, Iris
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Emilie du Châtelet wurde 1706 geboren, sie übersetzte erstmals Newtons »Principia«, veröffentlichte eine Schrift zu Leibniz und setzte sich in ihrer Korrespondenz mit den großen Denkern ihrer Zeit - Voltaire, Euler und Cramer - mit Fragen der Mathematik und Physik auseinander. In ihrer Rede vom Glück schrieb sie 1746, für das Glück sei es unerlässlich, vernünftig und tugendhaft zu sein, und für Illusionen empfänglich. Zwei Jahre später verliebt sie sich in einen Gardeoffizier, in der Liebe zu ihm schlug sie leidenschaftlich ihre Maximen in den Wind. Kurz darauf starb sie 43-jähr...
Emilie du Châtelet wurde 1706 geboren, sie übersetzte erstmals Newtons »Principia«, veröffentlichte eine Schrift zu Leibniz und setzte sich in ihrer Korrespondenz mit den großen Denkern ihrer Zeit - Voltaire, Euler und Cramer - mit Fragen der Mathematik und Physik auseinander. In ihrer Rede vom Glück schrieb sie 1746, für das Glück sei es unerlässlich, vernünftig und tugendhaft zu sein, und für Illusionen empfänglich. Zwei Jahre später verliebt sie sich in einen Gardeoffizier, in der Liebe zu ihm schlug sie leidenschaftlich ihre Maximen in den Wind. Kurz darauf starb sie 43-jährig bei der Geburt der gemeinsamen Tochter.