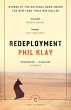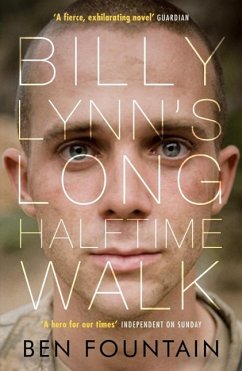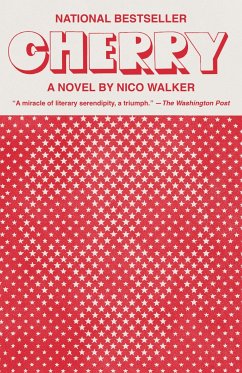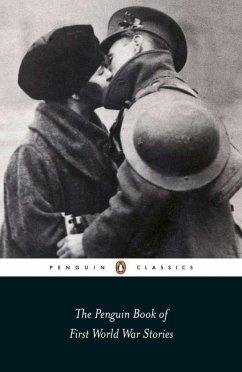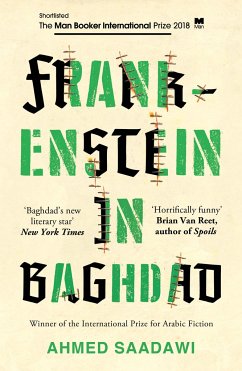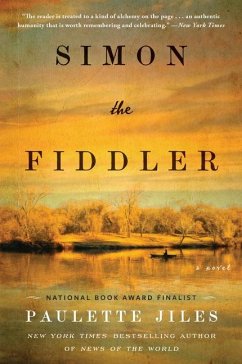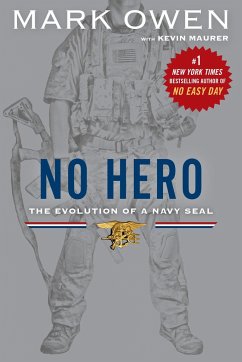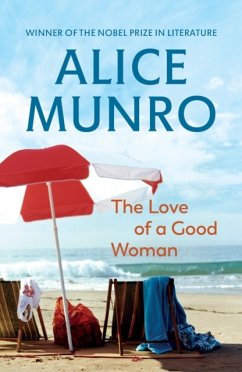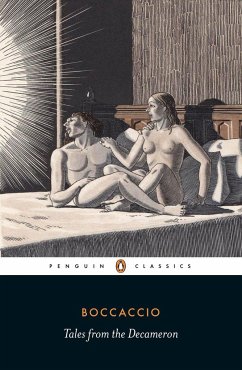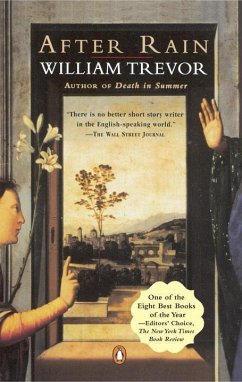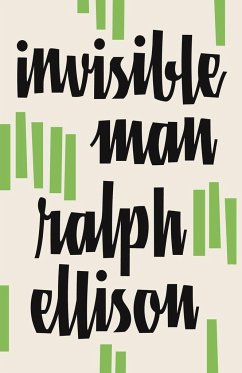Redeployment
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
16,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
The New York Times bestselling and National Book Award-winning story collection which takes readers to the frontline of the Iraq wars. 'A must read' Guardian