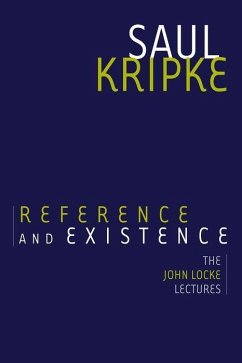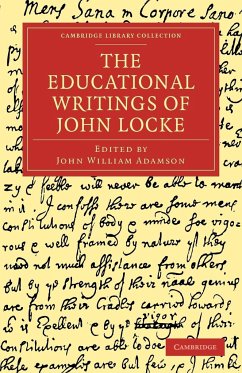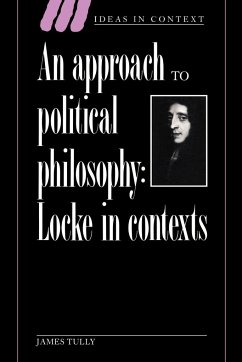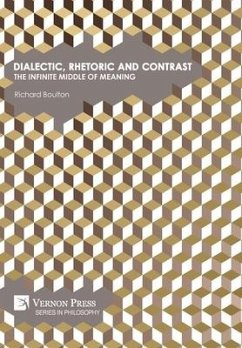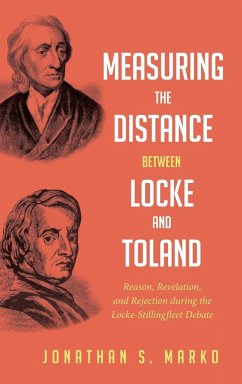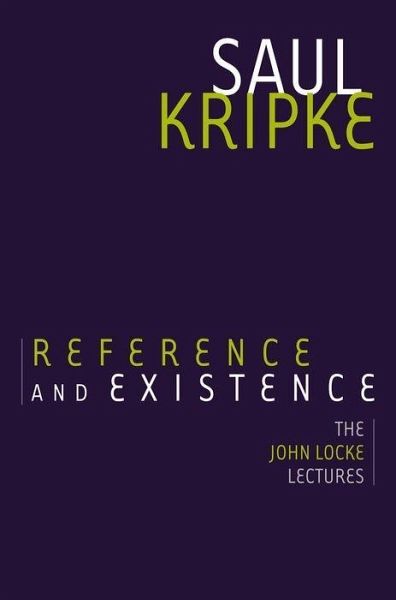
Reference and Existence
The John Locke Lectures
Versandkostenfrei!
Versandfertig in über 4 Wochen
76,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
38 °P sammeln!
This volume collects Saul Kripke's Locke Lectures, which were delivered in Oxford in 1973.