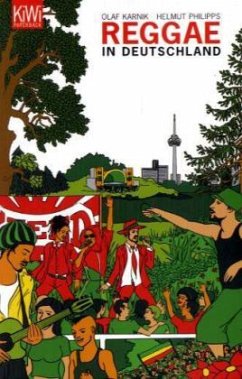Die Geschichte des Reggae in Deutschland Noch nie ist die Geschichte des Reggae in Deutschland erzählt worden, dabei gehört diese Musik auch hierzulande zu den erfolgreichsten Strömungen der letzten Jahre. Olaf Karnik und Helmut Philipps haben sich auf die Suche nach den Ursprüngen gemacht und stellen zum ersten Mal die wichtigsten Artists, Platten, Produzenten, Labels und Sound Systems aus Deutschland vor.Ganz frühe Spuren hinterließ eine 22-jährige Jamaikanerin. Das war 1964 und Millie Small landete mit My Boy Lollipop auf Platz 5 der deutschen Charts. Den ersten "richtigen" Reggae aus Deutschland gab es erst viel später. In Magdeburg gründete sich 1980 Reggae Play, in Westdeutschland beinahe zur selben Zeit die Taugenixe. Doch in den Medien fand deutscher Reggae noch keinen Widerhall der Sound galt weiterhin als Synonym für Bob Marley, Kiffen und Exotik. Erst mit Gentleman und den ersten deutschen Sound Systems (DJ-Crews), die den neuen Dancehall-Sound propagierten, sollte sich das ändern.Heute verbringen deutsche Reggae-Musiker viele Monate im Jahr auf Jamaika und nehmen dort ihre Platten auf. Umgekehrt kommen Jamaikaner nach Deutschland und produzieren hier Musik. Und so wunderte sich auch niemand mehr, als zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland die Berliner Dancehall-Combo Seeed auftrat.Reggae ist trotzdem eine Subkultur und vielleicht auch eine der letzten Gegenkulturen geblieben, die ihre ganz eigenen Gesetze hat und eine spannende wie ungewöhnliche Geschichte.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Instruktiv scheint Rezensent Andreas Hartmann dieses Buch über "Reggae in Deutschland", das Olaf Karnik und Helmut Philipps vorgelegt haben. Er attestiert den Autoren, profund über diesen Musikimport aus Jamaika nach Deutschland, seine Ausbreitung und die Szene in Deutschland zu berichten. Deutlich wird für ihn dabei das Gewachsene, das Neben- und Durcheinander dieser Kultur in Deutschland, wo es inzwischen Acts wie Gentleman und Seeed gibt, die selbst in Jamaika erfolgreich sind. Außerdem kämen Szeneaktive zu Wort, die genauere Einblicke in die Szene geben. Hartmann vermisst indes eine stärkere Einbeziehung von "diskursiveren, 'cultural studies'-artigen Erklärungsversuchen". Zudem bleibt für ihn im Dunkeln, woher die Begeisterung für die Reggae-Kultur stammt. Antworten auf einfache soziologische Fragen wie "wer genau hört was und warum?" findet er in dem Buch nicht, das die Autoren seinem Eindruck nach "eher für die Szene geschrieben haben".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH