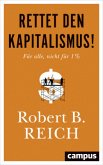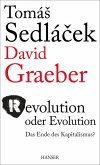Das neue Buch von Sahra Wagenknecht»Es ist Zeit, sich vom Kapitalismus abzuwenden«, sagt Sahra Wagenknecht. Denn der Kapitalismus ist längst nicht mehr so innovativ, wie er sich gibt. Bei der Lösung der großen Zukunftsfragen - von einer klimaverträglichen Energiewende bis zu nachhaltiger Kreislaufproduktion - kommen wir seit Jahrzehnten kaum voran. Für die Mehrheit wird das Leben nicht besser, sondern härter.Es ist Zeit für eine kreative, innovative Wirtschaft mit kleinteiligen Strukturen, mehr Wettbewerb und funktionierenden Märkten, statt eines Wirtschaftsfeudalismus, in dem Leistung immer weniger zählt, Herkunft und Erbe dagegen immer wichtiger werden.Sahra Wagenknecht fordert- eine andere Verfassung des Wirtschaftseigentums,- die Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und- die Entflechtung riesiger Konzerne, deren Macht fairen Wettbewerb und Demokratie zerstört.- Talent und echte Leistung zu belohnen und Gründer mit guten Ideen ungeachtet ihrer Herkunft zu fördern.Mit ihrem Buch eröffnet Wagenknecht eine politische Diskussion über neue Eigentumsformen und die vergessenen Ideale der Aufklärung. Sie legt eine scharfsinnige Analyse der bestehenden Wirtschaftsordnung vor und zeigt Schritte in ein demokratisch gestaltetes Gemeinwesen, das niemandem mehr erlaubt, sich zulasten anderer zu bereichern.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Markus Günther kann nur staunen, wie souverän Sahra Wagenknecht fast sämtliche Fehler des Politikerbuches vermeidet. Keine Eitelkeiten, kein Geprahle mit eigenen politischen Erfolgen, meint Günther. Stattdessen stößt er auf Sachkenntnis, analytische Schärfe, einen gut lesbaren (mutmaßlich selbst verfassten) Stil, kluge Beobachtungen und ideenreiche, fundierte Argumente, wenn es darum geht, unsere Wirtschaftsordnung zu erläutern, ökonomische Denkschulen vorzustellen und dem Leser die Verbindungen von Kapital, Waren, Arbeit und Mensch verstehbar zu machen. Als Kompliment ordnet der Rezensent ein, dass er der Autorin mitunter gern widersprechen würde. Etwa, wenn sie Rot-Grün von 1998 die wachsende Ungerechtigkeit im Land in die Schuhe schieben möchte. Ein gelungenes Propädeutikum der deutschen Wirtschaft, das laut Günther gar nicht durchweg klassisch links argumentiert und, für den Rezensenten überraschend, nationalstaatliche Lösungen propagiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wenn das jetzt Kommunismus ist, kann man darüber reden: Sahra Wagenknecht entwirft in "Reichtum ohne Gier" eine gerechtere Wirtschaftsordnung und hat noch eine Rechnung offen.
Das Genre des Politikerbuches teilt sich in zwei Gruppen. Einerseits sind da die abgetretenen Politiker, meist im fortgeschrittenen Alter, die zum Zwecke der Rechtfertigung oder Ruhegeldaufbesserung, manchmal auch nur aus Ranküne oder Frust über den eigenen Bedeutungsverlust Autobiographisches und Apologetisches schreiben. Andererseits die noch aktiven Politiker, die unter Zweitverwertung ihrer Reden und Strategiepapiere ein politisches Programm vorlegen und damit bestenfalls eine Debatte anstoßen wollen, sich schlechtestenfalls einfach nur wichtigtun. Beiden Gruppen gemeinsam ist, dass sie meist auf einen Ghostwriter (Ko-Autor oder Mitarbeiter genannt) zurückgreifen müssen und dass unter den genannten Voraussetzungen Bücher entstehen, die die Welt beim besten Willen nicht braucht.
Für das neue Buch von Sahra Wagenknecht gilt nichts von alledem. Ihre dreihundert mutmaßlich selbst geschriebenen, sehr gut lesbaren und mit klugen Beobachtungen und Argumenten gefüllten Seiten sind der schöne, seltene Ausnahmefall des Politikerbuches: ideenreich, fundiert, anregend. Man würde ihr gern an vielen Stellen Einwände und skeptische Fragen entgegenhalten, manchmal will man auch rundheraus widersprechen, aber das spricht nicht gegen ihr Buch. Nur einen einzigen typischen Politikerfehler macht sie dann doch. Dazu später mehr.
"Reichtum ohne Gier" ist ein Titel, der die leicht durchschaubare Absicht verfolgt, populäre Reizworte zu verbinden, doch ist Populismus das, was man der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag - unter den Bedingungen der großen Koalition also so etwas wie die deutsche Oppositionsführerin - in diesem Buch kaum vorwerfen kann. Zu einem erheblichen Teil ist es ein volkswirtschaftliches Propädeutikum, das Grundlegendes über die bestehende Wirtschaftsordnung erklärt, traditionelle Denkschulen der Ökonomie vorstellt und die Zusammenhänge zwischen Kapital, Waren, Arbeit und Menschen verständlich macht, namentlich unter den Bedingungen der Gegenwart. Dass diese Sichtweise politisch rot eingefärbt ist, versteht sich.
Dass Sahra Wagenknecht als Politikerin aber ernsthafter gearbeitet hat als die meisten Kollegen der Generation Guttenberg, merkt man ihrem Buch an. Sie zitiert die Vordenker der modernen Wirtschaft von Friedrich-August von Hayek bis Milton Friedman, wobei sie kaum auf klassische marxistische Denkmuster und die tradierten antiliberalen Reflexe zurückgreift. Stattdessen zeigt sie anhand vieler praktischer Beispiele, dass das Axiom des freien Marktes kritisch hinterfragt werden muss, weil vieles aus dem Ruder gelaufen ist.
Manches davon mag man banal finden, es ist aber dennoch wahr: "Der Kern der Macht der oberen Zehntausend und der Ursprung ihrer leistungslosen Bezüge ist die heutige Verfassung des Wirtschaftseigentums. (. . .) Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts konzentrieren sich in der Verfügung der reichsten 1 Prozent die wichtigsten wirtschaftlichen Ressourcen. Erneut arbeiten 99 Prozent der Bevölkerung zum überwiegenden Teil, direkt oder indirekt, für den Reichtum dieses neuen Geldadels."
Dazu ließe sich manche Fußnote anbringen, etwa dass schon jetzt eine erhebliche Umverteilung stattfindet und neben dem Wohlstand auch die Steuerlast extrem ungleich verteilt ist, aber im Kern wird doch die richtige Frage angesprochen: Warum gelingt es dem angeblich so überlegenen System eines freiheitlich organisierten Kapitalismus nicht, den vorhandenen Reichtum gerechter zu verteilen und aus den enormen Produktivitätssteigerungen ein Kapital zu schlagen, das allen und nicht nur wenigen zugutekommt?
Wagenknechts Vorschläge überraschen vor allem durch die Akzentuierung nationalstaatlicher Lösungen. Sie misstraut der Europäischen Union und der Währungsunion, nicht aus Nationalismus, sondern aus Furcht vor den unbeherrschbaren Kräften, die in einem übergroßen Markt, aber auch in den supranationalen Institutionen freigesetzt werden. Einfacher ausgedrückt: Staatliche Unterstützung für Rentner und Arbeitslose, Sozial- und Umweltstandards, all das lasse sich bei weitem besser im Nationalstaat organisieren, während die Europäisierung und Globalisierung immer nur den Konzernen in die Hände spiele, die vom Verbilligungswettbewerb der Lohn- und Sozialkosten (vulgo: Standortvorteil) zu Lasten der Arbeitnehmer profitierten.
In der Ablehnung der EU und der gemeinsamen Währung berührt sich die Linke Wagenknecht mit den Rechten in der AfD. Andererseits sind ihre Vorschläge zur Reform des Finanzmarktes dann doch wieder klassisch links: Gründung von "Gemeinwohlunternehmen" in denjenigen Sektoren, die für ein Spiel der freien Marktkräfte ungeeignet sind, straffe Regulierung des Finanzsektors mit Einführung der "Gemeinwohlbank" nach dem Sparkassen- und Genossenschaftsmodell. Wagenknecht gelingt es, auch dem skeptischen, liberalen Leser zu zeigen, wo die Grenzen der Marktfreiheit und wo die Chancen einer entschlosseneren staatlichen Ordnung liegen könnten. Wenn das mit "Kommunismus" gemeint ist, könnte man darüber reden.
Doch diplomatisch zurückhaltend umgeht die Autorin die Frage, wie diese neue Wirtschaftsordnung denn politisch durchgesetzt werden soll. Enteignung von Privatvermögen? Zerschlagung der Großbanken? Aufkündigung internationaler Verträge und Abkommen? Eigenartig, dass sie sich nicht traut, Klartext zu reden, wenn es um die realpolitische Perspektive geht. Was Sahra Wagenknecht will, müsste gegen die massiven Widerstände in Politik und Wirtschaft, es müsste auch gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und Vertragstreue, nicht zuletzt auch gegen Widerstand aus dem Ausland durchgesetzt werden. Bernie Sanders argumentiert ähnlich, aber er nimmt auch bei der Frage nach der politischen Umsetzung kein Blatt vor den Mund. Schade, dass Wagenknecht hier so kleinmütig bleibt.
Dennoch, die Autorin macht viel mehr richtig als falsch. Beeindruckend sind ihre Sachkenntnis, ihr analytischer Blick und die schlichte Tatsache, dass sie die typischen Fehler der Politikerbücher - Eitelkeit, Prahlerei mit den eigenen politischen Erfolgen - vermeidet. Nur einer Versuchung kann Sahra Wagenknecht nicht widerstehen: Da ist noch eine alte Rechnung offen, die sie begleichen will, und es ist nicht ihre eigene, sondern die ihres zweiten Ehemanns Oskar Lafontaine, dessen vierte Ehefrau sie ist. Seine Intimfeindschaft zu Gerhard Schröder flammt in Wagenknechts Buch immer wieder auf.
Und sie kommt immer wieder auf die Schicksalsjahre 1998/99 zurück. Die rot-grüne Koalition, aus der Lafontaine entmutigt ausschied, soll mit ihren Hartz-IV-Reformen, so argumentiert nun auch Wagenknecht, die entscheidende Weiche für die wachsende Ungerechtigkeit in Deutschland und die neue Verarmung der Massen gestellt haben. Schröder und Fischer, die Verräter der deutschen Linken? Es ist der einzige Affekt, den sich Sahra Wagenknecht in diesem klugen Buch erlaubt.
MARKUS GÜNTHER
Sahra Wagenknecht: "Reichtum ohne Gier". Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten.
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2016.
292 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»In 'Reichtum ohne Gier' seziert die Fraktionsvorsitzende der Linken präzise die zentralen Fehlbildungen unserer Wirtschaftsordnung: die Einmischung des Staates an falscher Stelle.« Corinna Nohn, Handelsblatt, 14.10.2016 »Sahra Wagenknecht hat mit 'Reichtum ohne Gier' ein gescheites, aufrüttelndes und überaus differenziertes Plädoyer für eine sozial gerechtere und innovativere Wirtschaftsordnung geschrieben. Bravo!« Hans Durrer, Huffington Post, 07.05.2016 »Wagenknecht analysiert die weltweite Monopolisierung und die erkundet den Eigentumsbegriff, der über die Jahrhunderte unterschiedlich bewertet wurde. Sie erläutert Funktionsweisen und Unternehmensstrukturen im Kapitalismus.« Wolfram Wessels, SWR2 Forum Buch, 24.04.2016 »Sahra Wagenknecht legt ein überraschend progressives Buch vor. [...] Ein weit größerer Wurf als das hoch gehandelte neue Buch Marcel Fratzschers.« Sebastian Puschner, Der Freitag, 28.04.2016 »Das Buch [bietet] einen tiefen Blick auf viele Probleme unserer Wirtschaftsordnung sowie etliche interessante und innovative Lösungsvorschläge. Es lädt dazu ein, manche Allgemeinplätze zu hinterfragen und die Voraussetzungen unserer Wirtschaft neu zu denken.« Dr. Max Otte, boerse.de, 15.03.2016 »Das Buch 'Reichtum ohne Gier -Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten' ist wirklich gut geschrieben. Die Autorin beherrscht die Kunst des klaren Denkens und kennt sich über den Unterschied von Haben und Nichthaben auch in der Praxis aus.« Peter Gauweiler, Süddeutsche Zeitung, 29.03.2016 »Ich habe dieses intelligent für eine neue Wirtschaftsordnung argumentierende Buch der promovierten Volkswirtschaftlerin Sarah Wagenknecht mit Gewinn gelesen.« Denis Scheck, ARD "Druckfrisch", 24.04.2016 »ideenreich, fundiert, anregend (...) Wagenknecht gelingt es, auch dem skeptischen, liberalen Leser zu zeigen, wo die Grenzen der Marktfreiheit und wo die Chancen einer entschlosseneren staatlichen Ordnung liegen könnten.« Markus Günther, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.05.2016 »[Sahra Wagenknecht] liefert - ökonomisch höchst kenntnisreich und dabei gut verständlich geschrieben - ein Plädoyer für die Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft ab. Und zwar als Alternative zu einem Kapitalismus, in dem sich der Reichtum der Reichsten aus dem bereits angehäuften Kapital immer weiter nährt.« Stephan Hebel, Frankfurter Rundschau, 01.11.2016