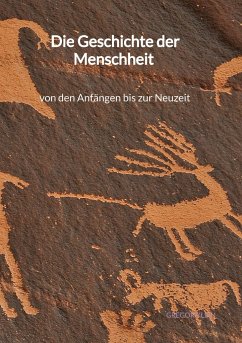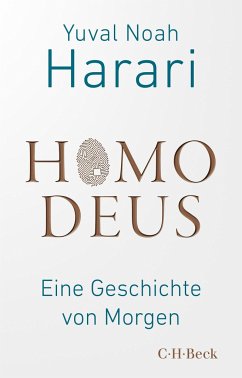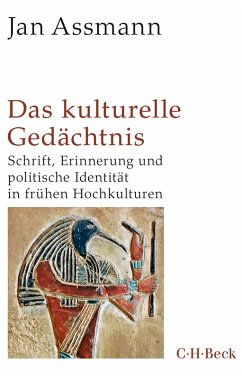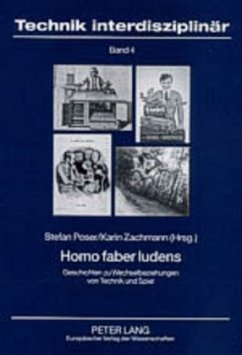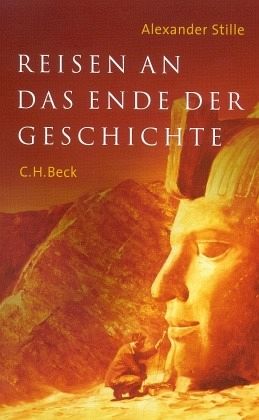
Reisen an das Ende der Geschichte
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
9,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Infrarot-Kameras, Karbon-Datierung, DNA-Analyse, Digitalisierung wir haben heute die besten Technologien für das Studium und die Bewahrung von Überlieferungen. Zugleich zerstören Abgase unersetzbare Steinreliefe, ruinieren Besucherströme prähistorische Höhlen, und in amerikanischen Archiven werden Dateien der 70er Jahre unlesbar die Nebenfolgen von Technologieentwicklung und Globalisierung zerstören unersetzliche Reste der Vergangenheit, Kulturen mitsamt ihren Sprachen und materiellen Traditionen, und wir erleben einen rapiden Schwund von Tier- und Pflanzenarten. Faszination und Bewahru...
Infrarot-Kameras, Karbon-Datierung, DNA-Analyse, Digitalisierung wir haben heute die besten Technologien für das Studium und die Bewahrung von Überlieferungen. Zugleich zerstören Abgase unersetzbare Steinreliefe, ruinieren Besucherströme prähistorische Höhlen, und in amerikanischen Archiven werden Dateien der 70er Jahre unlesbar die Nebenfolgen von Technologieentwicklung und Globalisierung zerstören unersetzliche Reste der Vergangenheit, Kulturen mitsamt ihren Sprachen und materiellen Traditionen, und wir erleben einen rapiden Schwund von Tier- und Pflanzenarten. Faszination und Bewahrung einerseits, zugleich nie dagewesene Vernichtung von Kultur in diesem Paradox bewegen wir uns.
Alexander Stille nimmt uns mit auf seine Reise an Schauplätze auf der ganzen Welt, wo über die Erhaltung und Vernichtung von noch existierenden Spuren der Vergangenheit entschieden wird: wir streifen mit ihm durch die Altstadt von Kairo, hören die Erklärungen zum Wiederaufbau der Bibliothekvon Alexandria, sind mit im Boot über den Ganges, reisen mit dem italienischen Forscher Scoditti nach Kitawa in Papua Neu-Guinea, wo die Verschriftlichung die mündliche Überlieferung zerstört, und sehen, daß die Chinesen eine ganz andere Vorstellung von historischem Original haben als wir. Wir erleben den unterschiedlichsten Umgang mit Geschichte, sind Augenzeugen des unwiederbringlichen kulturellen Verlustes, des definitiven Endes vieltausendjähriger Überlieferung.
Ein Meisterwerk journalistischer Recherche, ein glänzend geschriebenes Buch.
Alexander Stille nimmt uns mit auf seine Reise an Schauplätze auf der ganzen Welt, wo über die Erhaltung und Vernichtung von noch existierenden Spuren der Vergangenheit entschieden wird: wir streifen mit ihm durch die Altstadt von Kairo, hören die Erklärungen zum Wiederaufbau der Bibliothekvon Alexandria, sind mit im Boot über den Ganges, reisen mit dem italienischen Forscher Scoditti nach Kitawa in Papua Neu-Guinea, wo die Verschriftlichung die mündliche Überlieferung zerstört, und sehen, daß die Chinesen eine ganz andere Vorstellung von historischem Original haben als wir. Wir erleben den unterschiedlichsten Umgang mit Geschichte, sind Augenzeugen des unwiederbringlichen kulturellen Verlustes, des definitiven Endes vieltausendjähriger Überlieferung.
Ein Meisterwerk journalistischer Recherche, ein glänzend geschriebenes Buch.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.