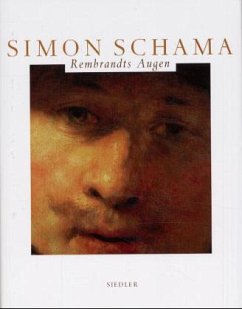Bilder einer Epoche »Für Rembrandt wie für Shakespeare war die ganze Welt eine Bühne, und er wusste bis in die kleinsten Einzelheiten, nach welcher Taktik die Vorstellung lief: das großspurige und das gezierte Auftreten; die Kostüme und Masken; das ganze Repertoire an Gesten und Grimassen; das Gestikulieren der Hände und das Rollen der Augen; das vollbauchige Lachen und das halberstickte Seufzen. Er wusste, wie es aussah, wenn jemand verführte, einschüchterte, schmeichelte oder tröstete; wenn sich einer in Positur setzte oder ein Gebet sprach; wenn einer jemandem drohte oder sich an die Brust schlug; wenn einer eine Sünde beging oder bereute; wenn einer einen Mord oder aber Selbstmord beging. Kein Künstler war je so fasziniert von der Ausstattung seiner Charaktere, angefangen bei seiner eigenen Person. Kein Maler schaute je mit so schonungsloser Intelligenz und so abgrundtiefem Mitgefühl auf unsere Auftritte und unsere Abgänge und das ganze dazwischen liegende Spektakel.« Simon Schamas Buch verbindet auf ganz ungewöhnliche Weise Biografie und Kunstgeschichte. Er macht seine Leser anhand der Bilder Rembrandts mit dessen Welt vertraut, mit ihren Figuren und Gedankenentwürfen, aber auch mit ihren Geräuschen und Gerüchen oder mit den großen politischen Strömungen des siebzehnten Jahrhunderts: dem Krieg der protestantischen Niederlande gegen das katholische Spanien, dem extremen Calvinismus in Rembrandts Geburtsstadt Leiden, mit den Forderungen seiner Auftraggeber und mit seinen Zeitgenossen. Schama zeigt, welche Schlüsselrolle Rembrandts geliebte Frau Saskia und, nach ihrem Tod, seine Geliebte Hendrijcke Stoffels einnahmen. Er zeigt den Einfluss von Peter Paul Rubens, von dem Rembrandt sich später löste. Seite für Seite schafft Schama in seinem glänzend geschriebenen Buch Rembrandts Leben neu. Er sieht die Welt mit Rembrandts Augen.

Simon Schama überwältigt uns mit dem interplanetarischen Wesen von Rembrandt / Von Wilfried Wiegand
Viele Meister sind berühmt, aber keiner ist berühmter als Rembrandt. Unter den großen Malern ist er der einzige, von dem seit nun schon anderthalb Jahrhunderten unermüdlich betont wird, wie modern er doch sei, wie wenig ihn eigentlich von uns trenne und wie einfach es deshalb ist, ihn zu begreifen. Rembrandt wurde zum romantischen Genie ernannt, zu einem Künstler à la Beethoven, Rimbaud oder van Gogh, der gegen alles Herkommen rebelliert und die Kunst dazu benutzt, seine seelischen Nöte zu veröffentlichen. Diese Vorstellung war so erfolgreich, daß die kunsthistorische Forschung ihr begreiflicherweise zu mißtrauen begann. In den achtziger Jahren kam es zur offenen Revolte. Gleich dreimal wurde der Versuch gemacht, das romantische, beim Publikum so beliebte Standbild zum Wanken zu bringen.
Der erste Versuch war der heftigste. Die Autoren des "Corpus of Rembrandt Paintings" glaubten, mit Hilfe gemäldetechnischer Untersuchungsmethoden seien sie in der Lage, Eigenhändiges von fremder Zutat zweifelsfrei zu unterscheiden. Ihr Versuch, das OEuvre radikal abzuspecken, löste eine Welle von Protesten aus, und schließlich mußten sie zugeben, daß sie über das Ziel hinausgeschossen waren und voreilig auch ein paar echte Rembrandts für unecht gehalten hatten. Damit war es um die Autorität des Unternehmens geschehen, das hochmütige "Corpus" rostet seitdem als Forschungsruine vor sich hin.
Fast gleichzeitig erschien die sensationelle Monographie von Gary Schwartz. Er untersuchte Rembrandts Leben, wie ein Kriminalkommissar nach einer Terroristenwohnung sucht, nämlich mit Hilfe der Rasterfahndung. Schwartz ging jedem Namen nach, der in den Rembrandt-Dokumenten vorkommt, kontrollierte, wer mit wem verwandt, bekannt, befreundet war, und plötzlich schien Amsterdam wie von einem Spinnennetz überzogen, in dessen Mitte der Künstler auf seine Beute lauerte. Rembrandt hatte sich in einen ehrgeizigen Kleinunternehmer verwandelt, und die Tragödie seines Lebens bestand darin, daß er es nicht schaffte, ein Großunternehmer à la Rubens zu werden.
Das Buch war kaum erschienen, da wurde es schon von Svetlana Alpers ausgeweidet, die instinktsicher erkannte, daß die ernüchternde These von Schwartz es niemals zu Bestsellerehren bringen würde (F.A.Z. vom 14. Juni 1989). Was aber, wenn man seine These einfach auf den Kopf stellte und Rembrandt nicht als Verlierer, sondern als Gewinner darstellte? Denn ein Verlierer, so erläuterte Alpers in ihrem Essay über "Rembrandt als Unternehmer", sei er nur, solange man seine Finanzen anschaut. An der Börse der ästhetischen Werte hingegen gehörte er von Anfang an zu den Gewinnern, und zwar durch eine ausgesprochen kluge Investmentstrategie. Bei Svetlana Alpers wird Rembrandt zum Direktor einer Kunstfabrik, die unermüdlich das Markenzeichen "Rembrandt" lanciert. Deshalb gibt es so viele Selbstbildnisse, deshalb hatte er so viele Schüler, und deshalb haben die Autoren des "Corpus" so viele Probleme mit der Eigenhändigkeit. Daß es sogar "Selbstbildnisse" gibt, an denen Rembrandt keinen Strich getan hat, die er aber eigenhändig signierte, war für das "Corpus" noch ein Rätsel gewesen.
Das alles ist rund fünfzehn Jahre her, und die Forschung ist inzwischen selbstverständlich weitergegangen. Aber sie tut ihre Arbeit wieder in einer ruhigen Atmosphäre und hält sich vom Marktplatz der Eitelkeiten fern. Nun aber, da "Rembrandts Augen" von Simon Schama auf dem Büchertisch liegen, ist es mit dem Frieden zumindest einen Augenblick lang vorbei. Das dicke Buch wurde als eine Herausforderung geschrieben. Zwar ist es so mit Details gespickt und durch Anmerkungen gesichert, daß wir dem Autor seine Kompetenz gerne glauben, zugleich aber kommt der Text auf so provozierende Weise erzählerisch daher, daß es wie eine Kriegserklärung an alle nüchterne Wissenschaftsprosa wirken muß. Erzählt Schama Rembrandts Leben wie einen Roman? Das wäre eine viel zu schwache Behauptung. In Wahrheit beschreibt er es wie einen Hollywoodfilm oder, um ganz genau zu sein: wie eine amerikanische Fernsehserie mit historischem Thema, mag sie nun "Kleopatra" oder "Die Wikinger" heißen. Jeder kennt derartige populärwissenschaftliche Serien, in denen abwechselnd Fundstücke, Dokumente und Schauplätze vorgezeigt oder aber dramatische Höhepunkte von Schauspielern dargestellt werden; dazwischen tritt ab und zu der Autor vor die Kamera und gibt über die Designerbrille hinweg ein kluges Statement ab.
Rembrandts Augen" liest sich über weite Strecken wie der Drehbuch-Entwurf so einer Serie, bis hin zu Überraschungsauftritten des Autors, beispielsweise in einem Kapitel, das bezeichnenderweise den Titel trägt "New York, 1998", oder wenn es mitten in einem anderen Kapitel plötzlich heißt: "Nun muß der Biograph erst einmal Atem holen." Daß das Schlußkapitel "Rembrandts Geist" gewidmet ist, läßt vermuten, daß Schama auch mit Fernsehproduktionen à la "Twin Peaks" innig vertraut ist.
Schama räumt großzügig ein, wie wichtig die Bücher von Schwartz und Svetlana Alpers für ihn waren. Von Schwartz übernimmt er den Gedanken, daß Rembrandt sich lange damit herumquälte, ein zweiter Rubens zu werden. Da diese Rivalität jedoch eine einseitige Angelegenheit ist, die sich nur auf der Rembrandt-Seite abspielt, verfällt Schama auf den wirkungsvollen Einfall, lang und breit zu erzählen, wer dieser bewunderte Rubens eigentlich gewesen ist. Es ist wie im Westernfilm: Ehe es zum Showdown kommt, werden wir mit beiden Gegnern ausgiebig bekanntgemacht. Die Rubens-Kapitel - es sind tatsächlich mehrere - beginnen mit dem hochdramatischen Ehekonflikt seiner Eltern. Immerhin hatte der Vater eine Adlige geschwängert und mußte dafür ins Gefängnis, aber seine Frau verzieh ihm und bekam ihn schließlich frei. Auch das Leben des berühmten Sohnes war nicht arm an Höhepunkten, wenngleich von anderer Art, und zum Glück hat sich, wie zum Schicksal der Eltern, auch zu seinem eigenen eine ganze Reihe zeitgenössischer Dokumente erhalten. Welch erstaunliche Kunstleistungen Rubens vollbrachte, legt Schama mit Bewunderung und Kennerschaft dar. Bei der Interpretation einzelner Bilder sind die historischen Daten und ein solides Geschmacksurteil seine treuesten Verbündeten.
Alles in allem widmet er Rubens, dem Vorbild und Gegner, hundertfünfzig Seiten. Erst auf Seite 195 sind wir endlich wieder bei Rembrandt angekommen, dessen Karriere als beständiger Kampf mit großen Rivalen dargestellt wird, erst mit Rubens und nach dessen Tod mit der Geisterarmee der kunsthistorischen Vergangenheit, der Tizian als Kommandant voranreitet.
Das Buch folgt einer eigenwilligen Dramaturgie, indem es die Augen des Malers zum Leitmotiv macht. Wie stellt Rembrandt Augen dar? Das wird zur Grundfrage vieler Bildinterpretationen. Die hohlen Augenlöcher im maskenhaften Selbstbildnis des jungen Malers; der tote Blick der Blinden, die nach alter Tradition in Wahrheit das Innere schauen; der versteckte Blick des Malers über die Schulter eines Offiziers der "Nachtwache" - solche Beobachtungen werden bei Schama zu Pointen der Bildbeschreibung. Aber diese Fixierung auf das Auge läßt sich nicht durchhalten, ohne daß es lächerlich würde. Das weiß auch Schama, aber andererseits ist er doch so stolz auf seinen schönen Einfall, daß er sich nur ungern davon trennt. Also wird uns neben der Kunst auch die gesamte Außenwelt als Objekt von Rembrandts besonderem Blick präsentiert. Die ganze damalige Lebenswirklichkeit in Amsterdam war gleichsam blind und brauchte das Auge Rembrandts, um ihrer selbst gewahr zu werden. Dieser Gedanke wird mit viel schriftstellerischem Schmalz bestrichen - streckenweise meint man, Süskinds "Parfüm" zu lesen -, stellt sich aber, wenn man ihn zu Ende denkt, als Trivialität heraus.
"Rembrandts Augen" ist weder eine Biographie noch eine Monographie der Kunstwerke, sondern beides, also eine Gesamtdarstellung, die Leben und Werk möglichst eng verknotet und möglichst lückenlos erzählt. Das versucht der Autor so "filmisch" wie möglich, aber da er sich nur an die Tatsachen halten will, ergibt sich schon bald ein Problem. Denn wie soll er sich verhalten, wenn die Quellen einmal dünner sprudeln oder versiegen? Normalerweise ist das der Moment, wo Historiker zu schweigen beginnen oder allenfalls mit Analogien und Vermutungen vorsichtig erwägen, wie es vielleicht gewesen sein könnte. Bei Schama geht es da schon etwas anders zu.
Schweigen ist seine Sache nicht, phantasievolles Ausmalen um so mehr. Am meisten gerät er in Fahrt, wenn die Quellen nüchtern die Hauptsachen berichten, sich aber über die Details ausschweigen. Dann, wenn er sozusagen auf festem Tatsachenboden steht, gerät Schama ins Schwelgen. "Man kann sich die Szene leicht vor Augen führen", schreibt er beispielsweise und legt los: "Ein heller Frühlingsmorgen, endlich nach langer Wartezeit. Sonnenlicht fällt auf die jungen Kastanienblätter, Peter Paul trägt seinen besten breitrandigen Hut . . ." Bei einem anderen Anlaß kann man "ihn sich gut im Park von Kardinal Cesi vorstellen, an einem von Thymianduft erfüllten Sommernachmittag . . ." Der Autor weiß immer, welches Wetter herrscht, welche Blumen blühen und was die Personen gerade denken oder fühlen. Was sich auch ereignet haben mag, Schama war dabei. Fairerweise muß man allerdings einräumen, daß er bei wichtigen Behauptungen fast ausnahmslos durch Floskeln wie "vermutlich", "sicherlich" und "höchstwahrscheinlich" andeutet, wo das dokumentierte Wissen endet und die Auffüllung der Lücken beginnt.
Simon Schama, 1945 in London geboren, Professor für Geschichte und Kunstgeschichte an der Columbia-Universität in New York, ist ein erfolgreicher Autor. "Überfluß und schöner Schein", eine Kulturgeschichte von Hollands Goldenem Jahrhundert (deutsch 1988), war vermutlich sein bislang größter Erfolg. Der Kritik entging er schon damals nicht, aber alles in allem überwog doch die Zustimmung, und ebenso erging es seiner pünktlich im Jubiläumsjahr veröffentlichten Geschichte der Französischen Revolution ("Der zaudernde Citoyen"). Erst als zwei Jahre darauf "Wahrheit ohne Gewähr: Über zwei historische Todesfälle und das Vexierbild der Geschichte" erschien, begann das große Mißtrauen. Denn dort löste sich der Autor erklärtermaßen von den dokumentierten Fakten und gab einer fiktiven Geschichtsschreibung den Vorzug. Seither gilt Schama zumindest in Europa endgültig als ein schwarzes Schaf unter den Historikern und Kunsthistorikern. Das vorherrschende Urteil lautet seitdem, er sei - trotz literarischer Qualitäten - kein sachlich zuverlässiger Autor.
Wenn man "Rembrandts Augen" gelesen hat, möchte man dieses Urteil eher umdrehen. Schama ist in der Sache ein bemerkenswert kundiger Mann, aber seine literarischen Qualitäten, man kann es nicht verschweigen, haben eben nur das Niveau von Unterhaltungsromanen oder Fernsehspielen. Er hat, was die Anordnung des umfangreichen Stoffes betrifft, zweifellos glänzende dramaturgische Ideen, schreibt aber einen vulgären adjektivischen Stil, der bei sich selbst ist, sobald es sexuell zur Sache geht. Da gibt es "Brüste wie Puddingförmchen", allenthalben wird "gefummelt", und Dalilahs Bluse sieht aus, "als habe Samson sie in gieriger Ungeduld weggerissen, um sich an ihren üppigen Brüsten zu laben".
Einen großen Vorteil freilich hat selbst dieser Stil. Er ist nämlich, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse einem breiteren Publikum zu vermitteln, immer noch besser als der Jargon der kunsthistorischen Begriffsbürokraten. Auch ohne "großfigurige" Menschen, die "nahsichtig" im "Umraum" stehen und was dergleichen mehr ist, wird hier nämlich sehr sachkundig und durchweg auf dem heutigen Stand der Forschung über Malerei geschrieben. Was Schama über Rembrandts Hauptwerke - beispielsweise das Emmausbild im Musée Jacquemart-André, "Die Nachtwache", "Die Judenbraut" oder das Porträt des Jan Six - zu schreiben weiß, ist so erfüllt von intelligenter Begeisterung, daß ihm der Leser mehr als einmal dankbar ist.
Leider kann Schama manchmal nicht der Versuchung widerstehen, Bilder interessanter zu machen, als sie sind, damit sie besser zu seiner Vorstellung von Rembrandt passen. Ernüchternde Deutungen - beispielsweise daß Selbstbildnisse oft Arbeitsproben waren, mit denen Kunden für Porträtaufträge geworben werden sollten - verschmäht Schama begreiflicherweise, denn Rembrandts angeblich so aussagekräftige Augen spielten in einer derartigen Sicht keine große Rolle mehr. Ebenso fragwürdig ist Schamas psychologische Deutung der drei pornographischen Radierungen, in denen er Anspielungen auf Rembrandts eigene Probleme mit Frauen vermutet. Liegt es nicht näher, zu vermuten, daß der Künstler, vielleicht von einem Auftraggeber ermuntert, gehofft hat, Geld damit zu machen?
Die Provokation des Buches steckt in seiner durchgehend spürbaren These, daß Rembrandt und überhaupt die Menschen des Barock nicht so viel anders waren als wir. Zumindest seien die Unterschiede nicht entfernt so groß gewesen, wie die vorherrschenden kulturhistorischen Theorien es behaupten. Schama rehabilitiert gewissermaßen den gesunden Menschenverstand, der das schon immer so gesehen hat, und damit widerspricht er der Hauptrichtung der neueren Rembrandt-Forschung. Legt man das Buch aus der Hand, so ist Rembrandt nicht in der Ferne des kunsthistorischen Weltraums verschwunden, sondern gerade eben im hellen Tageslicht auf unserem Planeten gelandet.
Schama weiß, wie heftig man ihm widersprechen wird, wenn er die prinzipielle Fremdheit der Vergangenheit leugnet. Nur an wenigen Stellen rechtfertigt er seinen Standpunkt, etwa wenn er erzählt, wie der von Rubens so geliebte Bruder ganz überraschend in jungen Jahren stirbt. "Wie fühlt man sich", schreibt Schama, "wenn der beste Freund stirbt? Wie fühlt man sich, wenn er außerdem noch der Bruder ist, und wenn dieser Bruder alles ist, was außer einem selbst und der kleinen Tochter von einer Familie geblieben ist, die einmal neun Mitglieder zählte? Historiker sagen uns gern, daß wir über diese Dinge nichts wissen können; daß die Trauer des 17. Jahrhunderts ebenso weit von unserer heutigen Empfindung entfernt ist wie die Trauerrituale der alten Sumerer; daß die Allgegenwärtigkeit von Pest und ruhrartigen Erkrankungen notwendigerweise zur Folge hatte, daß die Empfindlichkeiten besser gepanzert waren. Sie weisen uns darauf hin, daß ein plötzliches Ableben, das uns in die Verzweiflung treiben würde, von unseren Vorfahren als unanfechtbarer Ratschluß des Allmächtigen akzeptiert wurde. Natürlich haben sie in gewissem Maße recht, wenn sie uns warnen, unsere eigenen emotionalen Befindlichkeiten auf solche Kulturen zu projizieren, die noch unberührt sind von den Verzückungen und Qualen des romantischen Gefühls. Doch manchmal protestieren sie zu heftig gegen den Schock des Erkennens, die spezielle Vertrautheit, die wir intuitiv zu den vergangenen Jahrhunderten entwickeln." Das ist so überzeugend richtig, so eigentlich selbstverständlich, dabei so bestrickend klar und einfach, als hätte Ernst Gombrich es geschrieben.
Es ist schier unmöglich, von diesem Buch gelangweilt zu werden, was angesichts seiner 750 mit Fakten vollgestopften Seiten etwas heißen will. Und es ist, selbst wenn man das eine oder andere schon weiß, ebenso unmöglich, bei der Lektüre nichts dazuzulernen. Was also ist von diesem dicken Buch zu halten? Ist es gut, oder ist es schlecht? Es ist, um es in einem Wort zu sagen, ein Schmöker. Aber es ist ein intelligenter Schmöker, folglich der ideale Lesestoff für die Gebildeten unter seinen Verächtern.
Simon Schama: "Rembrandts Augen". Aus dem Englischen von Bettina Blumenberg. Siedler Verlag, Berlin 2000. 768 S., 180 Farb- u. 194 Schwarzweißabb., geb., Subskr.-Preis bis 31. 1. 2001 98,-, danach 128,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als Anreiz für einen Rekurs auf Rembrandt will Fritz Göttler zwei bereits im vergangenen Jahr erschienene Bücher in Erinnerung rufen: "Rembrandts Augen" von Simon Schama und Bernard Baas' Studie "Die Anbetung der Hirten oder Über die Würde des Helldunkels". Leider hat Göttler nichts als Kino im Kopf. Und so fällt ihm zu der an sich höchst spannenden Doppel-Signifikanz der von Baas mit Lacan, Heidegger und Valéry in Augenschein genommenen Radierung neben ein paar dem Band entliehenen Zitaten nur ein taubes "Gemaltes Kino eben" ein. Wirklich nicht viel.
Schama dagegen findet Göttler richtig "cool, weil er in seinem Riesenwerk immer wieder in die Close-up geht." Getipptes Kino eben, samt "Vertigo-Effekt", was heißen soll, dass "Schama sich in die Bilder hineinschraubt" oder der Leser - in die Bilder oder den Text. Denn in jedem Fall ist Schama "ein Suchender eher als ein Wissender." Genau wie der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
Schama dagegen findet Göttler richtig "cool, weil er in seinem Riesenwerk immer wieder in die Close-up geht." Getipptes Kino eben, samt "Vertigo-Effekt", was heißen soll, dass "Schama sich in die Bilder hineinschraubt" oder der Leser - in die Bilder oder den Text. Denn in jedem Fall ist Schama "ein Suchender eher als ein Wissender." Genau wie der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH