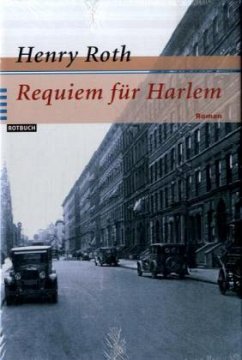Produktdetails
- Verlag: Rotbuch Verlag
- Seitenzahl: 402
- Deutsch
- Abmessung: 32mm x 145mm x 210mm
- Gewicht: 624g
- ISBN-13: 9783434531395
- ISBN-10: 3434531394
- Artikelnr.: 14472297
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Schuld und Sühne eines New Yorker Juden: Henry Roths "Requiem für Harlem" / Von Verena Lueken
Ira ist ständig in Bewegung. Er läuft durch East Harlem, von der hundertneunzehnten Straße in Höhe der Lexington zur Park Avenue, weiter zur Madison, zur Fifth, von dort Richtung Süden bis zur hundertsechzehnten und noch ein paar Blocks weiter zur hundertzwölften Straße, wo seine Cousine Stella wohnt. Er fährt mit der Subway, von der hundertsechzehnten zur zweiundvierzigsten Straße, wechselt dort die Linie und fährt weiter bis zur Christopher Street, steigt aus und geht das Stück bis zur Morton Street, wo seine spätere Geliebte Edith wohnt, zu Fuß. Er läuft am Bahndamm entlang, unterquert den El, steigt über Feuerleitern, und einmal fährt er sogar mit dem Taxi.
Und während er läuft und fährt und umsteigt und weiterläuft, pulsieren seine Gedanken, quälend, aufreizend, zweifelnd, nagend geil. Sein Gehirn, so glaubt er, sei in seinen eigenen Windungen gefangen oder zu Beton erstarrt und darin auch die immergleichen Fragen, die um seine Familie kreisen und um Sex. Das Problem ist, daß bei Ira beides dasselbe ist. Als er klein war, sah er, wie sein Onkel seine Mutter befingerte. Später entblößte sich der Onkel direkt vor ihm. Als Zwölfjähriger begann er, mit seiner Schwester Minnie zu schlafen. Als diese sich nach einigen Jahren von ihm zurückzog, ging er zur Cousine. An der fummelt auch sein Vater herum. Iras zweiter Gedanke ist die Flucht vor alldem.
Ira Stigman ist die Figur, die Henry Roth erfunden hat, um von sich selbst zu sprechen. Von seiner Kindheit an der Lower East Side und in Harlem in den Jahren um den Ersten Weltkrieg herum bis zu seiner Zeit am City College und dem Auszug aus der elterlichen Wohnung im Jahr 1927 hat er die Spuren Iras gelegt und in vier Bänden auf achtzehnhundert Seiten seine Geschichte ausgebreitet, einschließlich ausführlicher Ahnentafeln. "Die Gnade eines wilden Stroms" heißt diese Tetralogie nach einem Vers in Shakespeares König Heinrich VIII: "My high-blown pride at length broke under me, and now has left me, weary and old with service, to the mercy of a rude stream that must for ever hide me."
Shakespeare meinte das ironisch, Roth aber strebt tatsächlich nach Erlösung. Und ein wenig findet er sie auch am Ende von Iras Geschichte im vierten Band dieses Werks, der gerade erschienen ist. "Requiem für Harlem" ist ein Abschied - von einem Ort, von seiner Familie, von jüdischer Tradition, von der Jugend, vom Inzest und auch von einer Obsession. "Du selber bist es, den du verläßt." Und wahrscheinlich ist es der Schlußpunkt in Roths literarischem Werk. Roth starb 1995 und hinterließ zwei Stapel Papier. Aus dem einen wurde diese Tetralogie. Ob der andere je veröffentlicht wird, ist ungewiß.
Henry Roth, der mit dem nicht ganz zu Recht viel berühmteren Philip Roth nicht verwandt ist, galt lange Zeit als Ein-Buch-Autor. 1934 veröffentlichte er im Alter von achtundzwanzig Jahren die deutlich an James Joyce geschulte grandiose Einwanderergeschichte "Nenn es Schlaf", eines der prägenden Bücher der jüdisch-amerikanischen Literatur, ohne das die Werke von Saul Bellow und Philip Roth, J. D. Salinger und John Updike und vielen anderen nicht denkbar wären. Es geriet völlig in Vergessenheit. Erst in den sechziger Jahren kam es als Taschenbuch neu heraus und wurde in kurzer Zeit ein Bestseller. Roth hatte in der Zwischenzeit nichts veröffentlicht und tatsächlich wohl erst nach fünfundvierzig Jahren wieder angefangen zu schreiben. Längst schon lebte er nicht mehr in New York, sondern in Maine, später in New Mexiko, und arbeitete als Metallschleifer, Geflügelfarmer oder Mathematiklehrer. Insgesamt sechzig Jahre schwieg er, bis 1994 der erste Band der "Gnade eines wilden Stroms" erschien, dem im Lauf von vier Jahren in Amerika die anderen Bände folgten.
Es ist ein gewaltiges Werk. Roth begann daran zu arbeiten, als er schon über siebzig war, und vollendete es kurz vor seinem Tod mit annähernd neunzig. Die literarische Form ist weniger komplex als in "Nenn es Schlaf", aber immer wieder scheint passagenweise dieselbe Imaginationskraft durch, und es gibt lange Strecken, auf denen man spürt, wie glücklich Roth beim Schreiben gewesen sein muß, glücklich über die wiedergefundene kreative Energie, so sehr trägt der Rhythmus der Sätze und das sichere Gespür für die richtige Länge und Phrasierung den Leser weiter, bis dieser anfängt, im selben Takt und Tempo zu atmen wie Ira, dessen Gedanken einen Großteil des Buches füllen. Andere Male gelingt das nicht.
Roth erzählt, wie auch in den anderen Bänden, aus zwei Perspektiven - einmal von Ira, dem jungen Mann in den späten zwanziger Jahren in New York, der zwischen seinem jüdischen Elternhaus in Harlem und der Literaturprofessorin Edith in Greenwich Village hin und her pendelt; zum anderen von dem alten Mann, der dieses schreibt und dabei mit seinem Computer Zwiesprache hält. Er ist krank, inkontinent, schmerzgepeinigt, er hat Probleme mit der Zahnprothese, er erinnert sich an Gespräche etwa mit seinem Vater, die siebzig Jahre zurückliegen, erzählt von seiner Frau, die Komponistin war. Das Schreiben hält den Tod in Schach, Roth will die Geschichte, die wir lesen, bewältigen, bevor er stirbt. Einen "zweiten Versuch" nennt er das und fügt hinzu: "Du bist nicht verpflichtet, fertig zu werden, lautete das Diktum des Talmuds."
Gnade mit sich gehört sonst nicht zu den Konstanten dieses Werks. Eher Selbsthaß und eine im Wechsel triebhafte oder selbstverachtende Selbstbezüglichkeit, die Ira immer wieder an den Inzest, seine große Schuld, fesseln. Seine Sprache über Sex kommt aus der Gosse: "Zu romantischer Liebe warst du danach nicht mehr fähig. Dazu war es nun zu spät. Wie wolltest du denn eine phantasievolle, hochtrabende, poetische Diktion wählen, wenn dir die Wörter der Straße, die Slum-Wörter von Harlem in den Ohren klangen und du sogar schon wußtest, was sie bedeuteten? Und nicht nur vom Hörensagen: Das Fleisch wußte Bescheid . . ." Allgemeinere Sätze über Satan und die Sünde leiht Ira sich bei John Milton.
Iras Eltern sprechen anders. Die Mutter mischt oft fehlerhaftes Englisch mit jiddischen Vokabeln, auch der Vater spricht mitunter jiddisch, Edith hingegen in einer gepflegten, manchmal etwas bürokratischen Hochsprache. Heide Sommer, die bereits die ersten drei Bände der "Gnade" ins Deutsche gebracht hat, ist eine zuverlässige Übersetzerin dieses eigenwilligen Schriftstellers und seiner vielen Tonlagen.
Die verschiedenen Stimmen werden von den im chronologischen Ablauf recht traditionell erzählten spärlichen Ereignissen zusammengehalten. Doch mit welcher Wucht schreibt Roth über die gewalttätigen Streite der Eltern Iras, die einander nicht verzeihen, daß sie jeweils mit anderen Partnern ein besseres Leben gehabt hätten, über die Rettung, die zeitweise die Lektüre des "Verlorenen Paradieses" bereithält, darüber, wie kleine Dollarbeiträge den Besitzer wechseln, vom Vater zur Mutter, von der Tante zu Ira, von Edith zu Ira! Manchmal meint man, der alte Autor hätte die Sätze mit letzter Kraft, auch mit Zorn herausgestoßen, ohne Rücksicht auf sich selbst oder auf seine Leser, die er mit grellen Obszönitäten, immer wiederkehrenden pornographischen Phantasien, mit seinen Zweifeln am Judentum, seiner Abkehr vom Milieu der Einwanderer, seiner Scham und mit ungeheuer brutalen Familienzusammenkünften konfrontiert.
Henry Roths Erinnerungen passen in keine goldenen Rahmen, und die Geschichte, die er daraus macht, nicht in charmante Sätze. Natürlich hat auch Henry Roth keine Antwort auf die Frage, was es heißt, ein amerikanischer Jude zu sein. Sein autobiographischer Romanzyklus aber erzählt, was daran so schwierig ist.
Henry Roth: "Requiem für Harlem". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Heide Sommer. Rotbuch/EVA, Hamburg 2005. 405 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Otto Böhmer hat viel Lob zu verteilen. Zum einen an Henry Roth, der seiner Meinung nach zu Unrecht nicht so bekannt ist wie die beiden Namensvettern Joseph und Philip. Roth habe mit dem Abschluss seiner Romantetralogie über Ira Stigman ein "ungemein dichtes" Buch abgeliefert, mit einer "zeitlosen Botschaft". Nachdem der aus den vorherigen Büchern schon bekannte Stigman sich aus seinen Liebes- und Lebenswirren befreit hat und zu seiner New Yorker Dozentin gezogen ist, erkennt er nämlich, dass die einzig menschliche Konstante der stete Wandel ist. Lob geht auch an den Verlag, der mit Heide Sommer nicht nur eine "famose" Übersetzerin gefunden hat, sondern seinen editorischen Pflichten mit dem Nachwort und dem "umfangreichen" Glossar jiddischer und hebräischer Ausdrücke in vorbildlicher Weise nachkommt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH