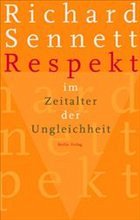Der Soziologe Richard Sennett stellt hier die Frage, ob eine Gesellschaft, die von großer sozialer Ungleichheit, ja Ungerechtigkeit geprägt ist, "Respekt" noch zulässt - die Achtung vor dem anderen, vor allem vor den Gescheiterten.
Erneut erweist sich Richard Sennett als konstruktiver kritischer Geist mit Weitblick, als jemand, der mit Hilfe anschaulicher Beispiele gesellschaftliche Missstände benennt.
Erneut erweist sich Richard Sennett als konstruktiver kritischer Geist mit Weitblick, als jemand, der mit Hilfe anschaulicher Beispiele gesellschaftliche Missstände benennt.

Ein Hochbegabter wendet sich den Tiefbetrübten zu: Richard Sennett zollt dem Sozialstaat Respekt / Von Andreas Rosenfelder
Der älteste Magnet für Respekt ist der Staat. Ein Ordnungshüter ruft einen Passanten an, dieser dreht den Kopf und blickt über die Schulter zurück: Der marxistische Philosoph Louis Althusser hat die zutiefst unsymmetrische Urszene des Respekts, das Zurücksehen, in ein schonungslos einfaches Bild gefaßt. In der Kultur des Ghettos jedoch hat dieses Schauspiel eine Umkehrung erfahren. Hier gilt gerade das Anblicken als verweigerte Ehrbekundung und kommt einer offenen Kriegserklärung gleich. Respekt besteht am Gegenpol des Staates, wo selbst die Polizei nur noch in Ausnahmefällen vorbeischaut, offenbar gerade in der Vermeidung von Zuwendung.
Wenn der Kulturwissenschaftler Richard Sennet ein umfassendes Werk über "Respekt im Zeitalter der Ungleichheit" vorlegt, dann tut der New Yorker Professor für Geschichte und Soziologe dies zunächst in seiner Eigenschaft als Respektsperson. Denn der mitunter scharfsinnige Kritiker des Bürgertums besitzt selbst alle Ehrenabzeichen des Bildungsbürgers, der Erforscher der Etikette nimmt seinerseits gerne die Haltung des moralischen Benimmlehrers an, und der bekennende Sozialist stellt sein kulturelles Kapital auf Vorträgen und im Fernsehen stets ohne falsche Bescheidenheit zur Schau.
Zugleich aber stammt Richard Sennett, geboren 1943, selbst aus einem Ghetto - der Sozialbausiedlung Cabrini Green im Westen Chikagos, wo nach dem Zweiten Weltkrieg Schwarze und verarmte Weiße, Kriegskrüppel und geistig Behinderte wohnten. Sennett weiß aus eigener Erfahrung, daß auch im Leben der infamen Menschen ein Ehrenkodex waltet. In seiner mit ein wenig Autobiographie angereicherten Abhandlung fallen zwei Gattungen zusammen. Als Bildungsroman führt das Buch den Erwerb von Respekt durch Selbstentfaltung vor: "Ich war zwar kein Wunderkind, aber ich komponierte, spielte Cello und hatte meine ersten Auftritte." Als Sozialstudie fordert es hingegen Respekt für die Welt der Erniedrigten und Beleidigten: "Wie kann man verhindern, daß Menschen sich angesichts ungleicher Talente entmutigen lassen oder Ressentiments entwickeln?"
Fast könnte der Leser vermuten, der arrivierte Wissenschaftler richte eine publizistische Wohltätigkeitsveranstaltung aus und lasse einen Teil seines soziologischen Ansehens an seine soziale Heimat zurückfließen. Doch auch wenn bereits der junge Akademiker auf Mentorenveranstaltungen in Cabrini Green auftrat, um den Jugendlichen seines alten Stadtviertels als Rollenmodell den Weg in die Gesellschaft zu weisen: Respekt erscheint hier keineswegs als Tauschgeschäft zwischen Individuen. Vielmehr legt Sennett die Verwaltung des knappen Gutes ganz in die Hände einer grauen Eminenz, die als strahlendes Vorbild kaum zu gebrauchen ist. Denn die wichtigste Quelle von Achtung findet Sennett im Sozialstaat.
Sennetts West Side Story, die von den Blickgefechten und Bandenkriegen des Ghettoalltags erzählt, bildet somit nur die wildromantische Kulisse für eine aufs Motiv der Ungleichheit gegründete Staatstheorie. Ausgerechnet der soziale Brennpunkt rückt als Keimzelle der Polis in den Blick, ausgerechnet im Ghetto zeichnen sich die Umrisse eines Gemeinwesens ab. Sennet sieht gerade in den von der Fürsorge möblierten Sozialwohnungen den Rahmen für Selbstrespekt, und in den von Ämtern kontrollierten Vierteln erkennt er den Grundriß der Autonomie. Selbst wo der Sozialstaat die Stadt verplant wie ein großes Kinderdorf und die Bewohner in unmündige Schützlinge verwandelt, verlieren die Sozialhilfeempfänger nicht notwendig das Bewußtsein der Selbstbestimmung. Denn das politische Wesen muß bei Sennett keineswegs Herr im eigenen Hause sein, es überlebt auch in den Grauzonen der Abhängigkeit.
Noch in seiner einschlägigen Studie zur "Tyrannei der Intimität" verteidigte Sennett die strikte Abschottung des Öffentlichen gegen das bürgerliche Privatleben - nun kassiert er scheinbar selbst die seit Aristoteles am Anfang aller Politik stehende Unterscheidung zwischen Polis und Oikos ein. Denn der Sozialstaat überwacht, wie Sennett mit Beispielen belegt, in seinen Modellsiedlungen selbst die Inneneinrichtung und die Haushaltsführung. Der Schlüssellochblick der Sozialfürsorge zieht sich durch Sennetts Bericht: Nicht allein die Beschreibung der ärmlichen Kleinwohnung in Cabrini Green zitiert der Autor aus den Tagebüchern und unveröffentlichten Kurzgeschichten seiner Mutter, die überdies als Sozialarbeiterin selbst zwischen Behörden und Wohnungen verkehrte.
Auf den ersten Blick wiederholt sich im Konzept des sozialen Wohnungsbaus genau jene Grenzverletzung zwischen innen und außen, welche Sennett vormals noch in den Glasfassaden der kapitalistischen Vorzeigebauten verkörpert fand. Doch auch wenn der in all seiner Ambivalenz befürwortete Sozialstaat bisweilen wie ein von außen einsehbares Puppenheim wirkt, scheint doch eine unsichtbare Wand des Respekts die Bewohner von den Betrachtern zu trennen. Diese fast theaterhafte Distanz soll die von Staats wegen gefallenen Sichtblenden ersetzen. Denn Sennetts Klage über das "Fehlen eines funktionstüchtigen unpersönlichen öffentlichen Bereichs", gerichtet ebenso gegen das liberale Vertrauen auf den Privatsektor wie gegen das konservative Setzen auf Mitgefühl, zielt als Forderung selbst auf ein durchweg ästhetisches Szenario.
Das begnadete Cellospiel, das den kleinen Richard vom kulturlosen Umfeld seines Wohnviertels abhob, findet in verwandelter Form seinen Weg zurück in die Straßen des Ghettos. Immer wieder vergleicht Sennett das Wirken des Staates mit einem Konzert: Sozialhilfe stellt eine strenge Aufführungspraxis dar, und im Respekt kommt eine verfeinerte Ausdruckskunst zur Vollendung. Allein eine Sozialarbeit der Kälte scheint in der Lage, die Autonomie der Bedürftigen zu achten - so lautet jedenfalls die Rechtfertigung für den kühlen und floskelhaften Jargon der Sozialtechnologen. Für Augenblicke nimmt Sennetts Ghetto die barocken Züge jener Hofstaaten an, in denen ein wertvoller Formelschatz das Ehrgefühl aller Höflinge ansprach und ihre Abhängigkeit von den Launen des Herrschers ausglich.
Der begründete Verdacht, daß hinter Sennetts Begriff des Respekts eine Neuauflage seiner Überlegungen zur Ehre steckt, muß keineswegs ehrenrührig sein - eher schon der Umstand, daß ausgerechnet das terminologische Kapitel des Buches wie ein unsortierter Zettelkasten daherkommt und jede durch das Begriffsfeld von Ansehen, Talent und Selbstachtung leitende These vermissen läßt. Überhaupt schaltet Sennett ein wenig planlos zwischen Begriffsklärungen und Lebensweisheiten hin und her: "Der Wunsch nach hervorragenden Fähigkeiten setzt Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit voraus - sich durchwursteln kann nicht das Ziel sein." Und immer wieder streift die auf Haltungen ausgerichtete Theorie der Sozialhilfe eine Kalenderspruchmoral der kleinen Gesten.
Über eine sozialpsychologische Verhaltenslehre geht Sennetts anregendes Buch dennoch weit hinaus. Denn hinter jeder Sozialarbeit stehen letztlich die bürokratischen Anlagen des Sozialstaats, die gerade durch ihre abschreckende Unpersönlichkeit für Anerkennung bürgen. Das nahezu leidenschaftliche Bekenntnis zur Büroherrschaft mag man als Ausschweifung des Versorgungsdenkens abtun. Doch die in diesem Zusammenhang skizzierte Geschichte der Bürokratie läßt eine ebenso überraschende wie aufschlußreiche Abstammungslinie des Sozialstaats aufleuchten, die nicht allein mit Seitenblick auf den Schauplatz Chicago überzeugt. Sennett bezeugt nichts anderes als die Geburt des Sozialhilfesystems aus dem Geiste des Kartells. Wuchernde Bürokratien, so Sennett, entstanden zunächst als Bindestoff jener großindustriellen Trusts, die das Vertrauen schon im Namen führen. Mittels pyramidenförmiger Hierarchien und langer Befehlsketten minderten die zusammengeschlossenen Konzerne ihre eigene Unberechenbarkeit. Der Sozialstaat brauchte diese Organisationsphilosophie dann lediglich zu übernehmen, um seinerseits die hektischen Veränderungen des Wirtschaftssystems durch die Langsamkeit des Apparats aufzufangen. Die entscheidende Leistung der Bürokratie liegt nach Sennett in der Verwaltung von wechselseitigem Respekt: Womöglich bildet der Sozialstaat, dessen Blick noch auf der heruntergekommensten Wohngegend ruht, die letzte wirklich ehrenwerte Gesellschaft.
Richard Sennett steht in echter Bewunderung vor jener Pyramide des Sozialstaats, die uns das zwanzigste Jahrhundert wie ein baufälliges Menschheitswunder hinterlassen hat. Sein Buch vollzieht einen Bruch mit der Institutionsfeindlichkeit seiner Generation, die in öffentlichen Einrichtungen in der Regel nur Gefängnisse sah und bei jeder Gelegenheit zur Befreiung ihrer Insassen aufrief. Sennett wendet all seine Raffinesse auf, um das Büro vor Foucault zu retten: Überwachen ist nicht notwendig gleich Strafen, der Staat besteht nicht allein aus Macht, und Befehlsketten müssen keine Fesseln sein. Denn das Sozialamt trägt bei Sennett weniger zum Ausschluß als zur Einbindung seiner Klientel bei. Jedes ausgefüllte Formular dient zugleich als Notenblatt, das den Antragsteller zum Ehrenmitglied im großen Staatsorchester macht. Nur Richard Sennett, der hochbegabte Junge aus dem Ghetto, sitzt einsam im Publikum und schaut zu. Ein wenig unglücklich sieht der erfahrene Kulturliebhaber dabei schon aus. Schließlich muß er als Erwachsener ebenjener Ordnungsmacht Respekt zollen, welcher er als Kind mit Glück entkam.
Richard Sennett: "Respekt im Zeitalter der Ungleichheit". Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff. Berlin Verlag, Berlin 2002. 344 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Kluge Fragen in einer sozialkritischen Debatte
Er ist Soziologe und Buchautor, vor allem aber ist er einer der wichtigsten Kulturkritiker der USA und gilt durch seine zahlreichen sozialkritischen Veröffentlichungen auch in Europa als jemand, der Debatten anschieben und führen kann. Richard Sennetts Buch Der flexible Mensch wurde in Deutschland zu einem Bestseller. Hier stellte er die provokante These auf: Nicht die Globalisierung der Märkte ist die große Bedrohung, sondern die neue Arbeitsorganisation. Mit Respekt im Zeitalter der Ungleichheit knüpft der Autor hier an und sucht nach Wegen, wie man die Bedürftigen im Sozialstaat unterstützt, ihnen dabei jedoch nicht die Würde nimmt, sondern die Menschen respektiert.
Musik als Weg zu mehr Respekt
Sennett wählte für die Abhandlung seines Themas eine Gratwanderung zwischen konkreter eigener Erfahrung und sozialwissenschaftlicher Theorie. Dazu outet er sich als im Sozialhilfesystem Aufgewachsener und bekennt, dass diese Erfahrung sein Leben prägte. Aus eigener Kraft entkam er dem Milieu, indem er seine Fähigkeiten und Talente nutzte, sich bis zu einer misslungenen Handoperation konsequent der Musik widmete. Kann aber wirklich alles, was ihn zu den theoretischen Überlegungen über Respekt und Ungleichheit führte, auf seine Erfahrungen mit Musik zurückgeführt werden? Will man den Denkmodellen Sennetts folgen, sollte man diese Frage mit Ja beantworten.
Drei moderne Gebote
Bei seinen Nachforschungen zum Thema Respekt analysiert der Autor den gesellschaftlichen Einfluss und fordert für den zwischenmenschlichen Umgang, dass man 1. die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln muss, 2. sich um sich selbst sorgen muss und 3. anderen etwas zurückgeben sollte. Wer Spaß daran hat, Sennetts klugen Anmerkungen zu einem Teilbereich der geistigen Situation unserer Zeit zu folgen oder sie kritisieren will, dem bietet das Buch jede Menge Ansatzpunkte. Allerdings stellt der Autor mehr Fragen, als er Antworten gibt.
(Mathias Voigt, literaturtest.de)
Er ist Soziologe und Buchautor, vor allem aber ist er einer der wichtigsten Kulturkritiker der USA und gilt durch seine zahlreichen sozialkritischen Veröffentlichungen auch in Europa als jemand, der Debatten anschieben und führen kann. Richard Sennetts Buch Der flexible Mensch wurde in Deutschland zu einem Bestseller. Hier stellte er die provokante These auf: Nicht die Globalisierung der Märkte ist die große Bedrohung, sondern die neue Arbeitsorganisation. Mit Respekt im Zeitalter der Ungleichheit knüpft der Autor hier an und sucht nach Wegen, wie man die Bedürftigen im Sozialstaat unterstützt, ihnen dabei jedoch nicht die Würde nimmt, sondern die Menschen respektiert.
Musik als Weg zu mehr Respekt
Sennett wählte für die Abhandlung seines Themas eine Gratwanderung zwischen konkreter eigener Erfahrung und sozialwissenschaftlicher Theorie. Dazu outet er sich als im Sozialhilfesystem Aufgewachsener und bekennt, dass diese Erfahrung sein Leben prägte. Aus eigener Kraft entkam er dem Milieu, indem er seine Fähigkeiten und Talente nutzte, sich bis zu einer misslungenen Handoperation konsequent der Musik widmete. Kann aber wirklich alles, was ihn zu den theoretischen Überlegungen über Respekt und Ungleichheit führte, auf seine Erfahrungen mit Musik zurückgeführt werden? Will man den Denkmodellen Sennetts folgen, sollte man diese Frage mit Ja beantworten.
Drei moderne Gebote
Bei seinen Nachforschungen zum Thema Respekt analysiert der Autor den gesellschaftlichen Einfluss und fordert für den zwischenmenschlichen Umgang, dass man 1. die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln muss, 2. sich um sich selbst sorgen muss und 3. anderen etwas zurückgeben sollte. Wer Spaß daran hat, Sennetts klugen Anmerkungen zu einem Teilbereich der geistigen Situation unserer Zeit zu folgen oder sie kritisieren will, dem bietet das Buch jede Menge Ansatzpunkte. Allerdings stellt der Autor mehr Fragen, als er Antworten gibt.
(Mathias Voigt, literaturtest.de)
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Es ist das "Prinzip der Gegenseitigkeit", so referiert Rezensent Ulrich Greiner, in dem Richard Sennet die Möglichkeit eines Ausgleichs ungleicher Chancen sieht. Der Hauptaugenmerk des Soziologen gilt der Frage, wie gegenseitiger Respekt und gegenseitige Anerkennung zu erreichen sind. Zwar findet der Rezensent dies eine lohnende Frage, aber da Sennet, anders als der von Greiner anfangs zitierte Norbert Elias, keine These beziehungsweise zu viele Thesen hat, empfindet der Rezensent die Lektüre dieses Buchs als "verwirrende Mühsal". Die soziologisch schwammigen Begriffe, mit denen Sennet arbeitet, werden selten durch Ausflüge in Empirie oder Geschichte wirklich erhärtet, findet Greiner. Ihn stört, dass der Gebrauch verschiedener Gattungen - autobiografisch-narrative Passagen wechseln sich ab mit Analyse und Reflexion - den Autor meist nur ausweichen lässt vor der Strenge philosophischer Begrifflichkeit. Für Greiner erklärt sich der Erfolg des Wissenschaftsautors Sennet denn auch vor allem damit, dass dieser "Stichworte zur geistigen Situation der Zeit liefert", jedoch über eine kluge Beschreibung unser aller Ratlosigkeit nicht hinaus geht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH