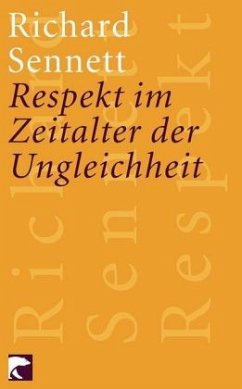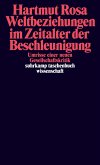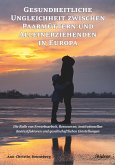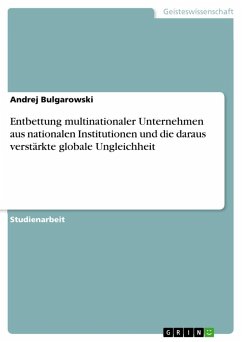Der Sozialstaat ist nicht nur für Wirtschaftsliberale anstößig. Auch liberale Linke, die für Umverteilung Sympathien hegen, können sich nur schwer damit abfinden, daß staatliche Fürsorge Abhängigkeiten schafft, die der Autonomie des Individuums zuwiderlaufen.
"Sozialhilfe ist ein Synonym für Demütigung", schreibt der amerikanische Soziologe Richard Sennett in seinem jüngsten Buch. Schlimmer noch: Sozialhilfe macht die Menschen zu bloßen Zuschauern ihrer eignenen Bedürfnisse, über welche die anderen besser Bescheid zu wissen vorgeben. Liberale und Linke kaprizieren sich deshalb zuweilen gemeinsam auf ein garantiertes Bürgergeld als Antwort auf die Falle demütigender Abhängigkeit. Doch ein Ausweg kann das nicht sein: Das Bürgergeld setzt falsche Anreize und hält die Menschen in der Bedürftigkeit. Deshalb, sagen andere, wäre es besser, ihnen den Weg zurück in die Arbeitswelt mit diskretem Zwang anzuempfehlen.
Sennetts Antwort ist das nicht. Er argumentiert weder systemtheoretisch noch ökonomisch, sondern sozialpsychologisch: Selbst wenn Ungerechtigkeiten verschwinden, Ungleichheiten wird es immer geben - man denke nur an die angeborenen Ungleichheiten unterschiedlicher Begabungen. Doch Ungleichheiten werden in den humanen Rahmen gerückt, wenn die Menschen einander mit Respekt anerkennen und dadurch Selbstachtung gewinnen.
Sennett entwickelt seine sozialpsychologische These aus der Erzählung autobiographischer Erfahrung: Der Geschichte seines eigenen sozialen Aufstiegs aus Cabrini Green, einer Sozialsiedlung in Chicago. "Ich hatte zwar nicht den Respekt vor den Zurückgelassenen verloren, doch mein eigenes Selbstwertgefühl basierte auf der Tatsache, daß ich sie hinter mir zurückgelassen hatte." Solche biographische Ehrlichkeit ist die Stärke von Sennetts Buch.
Der theoretische Ertrag bleibt freilich vergleichsweise mager. Eine Sozialpsychologie der Anständigkeit haben die Vorläufer - von Hannah Arendt bis Avishai Margalit - besser formuliert. Und eine Theorie der Ungleichheit - unter amerikanischen Ökonomen derzeit breit diskutiert - vermißt man bei Sennett komplett. Das Buch enttäuscht deshalb, trotzt aller anschaulicher Narrativität.
ank.
Richard Sennett: Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Berlin Verlag, 19,19 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Er streicht die Praxis des Respekts als zentralen Ausgangspunkt für sozialen Frieden heraus - eine wichtige Anregung für den Umgang mit Flucht und Migration.", Die Presse, Astrid Kury, 12.12.2015