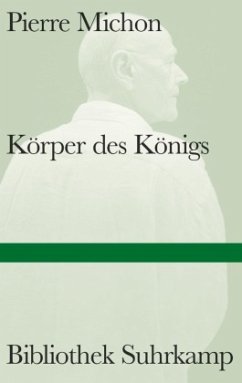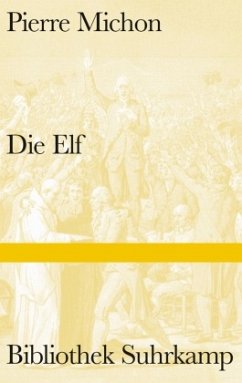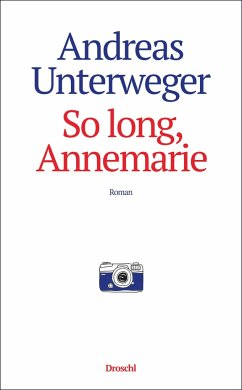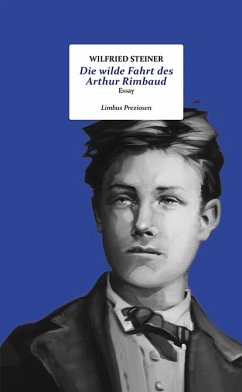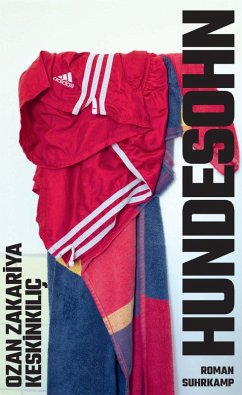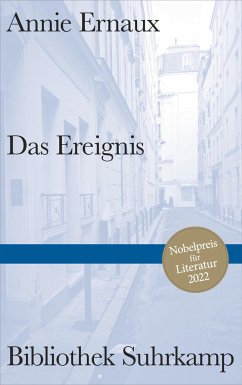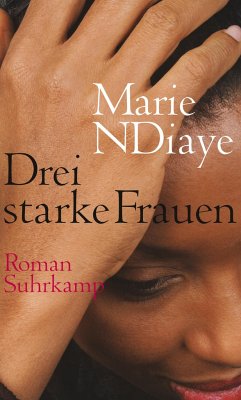Pierre Michon
Gebundenes Buch
Rimbaud der Sohn
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Rimbaud der Sohn ist eine Auseinandersetzung mit der Figur des Dichters und dem Wesen der Poesie, deren geradezu mythische Verkörperung der Dichterkomet Arthur Rimbaud im Verlauf des 19. Jahrhunderts geworden ist. Als Sohn erscheint Rimbaud in diesem Buch in mehrfacher Hinsicht: Sohn eines abwesenden Vaters und einer unzulänglichen bäuerlichen Mutter. Sohn mit einer langen Reihe von Vorfahren, die von Vergil bis zu Baudelaire reicht. Und schließlich Sohn einer anderen großen Abwesenden: der Poesie.
Michon, PierrePierre Michon wurde am 28. März 1945 im französischen Département Creuse (Massif Central), im Dorf Les Cards geboren, wo seine Eltern als Grundschullehrer arbeiteten. Zwei Jahre nach der Geburt des Sohnes verließ der Vater die Familie. Später studierte Michon in Clermont-Ferrand Literatur. Nach langen Jahren der schriftstellerischen Selbstfindung gelang ihm 1984 mit 37 Jahren der Durchbruch: Für Vies minuscules (Leben der kleinen Toten) erhielt er 1984 den »Prix France Culture«, dem weitere Preise folgten. Heute gilt Pierre Michon als einer der bedeutendsten französischen Gegenwartsschriftsteller. Übersetzungen seiner Werke erschienen in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Griechenland, Rumänien, den USA, Brasilien, Mexiko und Syrien. Pierre Michon lebt mit Frau und Tochter in Nantes.
Weber, AnneAnne Weber wurde 1964 in Offenbach geboren. 1983 ging sie nach Paris und absolvierte das Studium der französischen Literatur sowie der vergleichenden Literaturwissenschaften an der Sorbonne. Von 1989 bis 1996 arbeitete sie in Lektoraten verschiedener französischer Verlage. Sie begann, deutsche Texte (u.a. von Hans Mayer, Jacob Burckhardt, Eleonore Frey, Sibylle Lewitscharoff, Birgit Vanderbeke und Wilhelm Genazino) ins Französische zu übersetzen. 1998 veröffentlichte sie bei Le Seuil die französische Originalfassung von Ida erfindet das Schießpulver. 1999 erschien das Buch auf deutsch im Suhrkamp Verlag, der im Herbst 2000 auch Im Anfang war veröffentlichte. 2004 erschien ihr viertes Buch Besuch bei Zerberus.
Weber, AnneAnne Weber wurde 1964 in Offenbach geboren. 1983 ging sie nach Paris und absolvierte das Studium der französischen Literatur sowie der vergleichenden Literaturwissenschaften an der Sorbonne. Von 1989 bis 1996 arbeitete sie in Lektoraten verschiedener französischer Verlage. Sie begann, deutsche Texte (u.a. von Hans Mayer, Jacob Burckhardt, Eleonore Frey, Sibylle Lewitscharoff, Birgit Vanderbeke und Wilhelm Genazino) ins Französische zu übersetzen. 1998 veröffentlichte sie bei Le Seuil die französische Originalfassung von Ida erfindet das Schießpulver. 1999 erschien das Buch auf deutsch im Suhrkamp Verlag, der im Herbst 2000 auch Im Anfang war veröffentlichte. 2004 erschien ihr viertes Buch Besuch bei Zerberus.
Produktdetails
- Bibliothek Suhrkamp 1437
- Verlag: Suhrkamp
- Originaltitel: Rimbaud le fils
- Artikelnr. des Verlages: BS 1437
- Seitenzahl: 115
- Erscheinungstermin: 17. Oktober 2008
- Deutsch
- Abmessung: 180mm x 116mm x 15mm
- Gewicht: 182g
- ISBN-13: 9783518224373
- ISBN-10: 3518224379
- Artikelnr.: 23858808
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Etwas rästelhaft schreibt Rezensent Hans-Perter Kunisch über das 17 Jahre alte Rimbaud-Buch von Pierre Michon. Den biografischen Essay, wie Kunisch es nennt, kennt er als "herzeigenswertes Exempel" literarischer Hagiografie sehr französischer Art. Kritisch, sprachwitzig findet er den Text, spürt die Verfallenheit des Autors seinem Gegenstand gegenüber jedoch in jeder Zeile. Dass Michon nicht so sehr auf Rimbauds Herkunft abhebt, als auf dessen Konturierung durch ein Netz sozialer Beziehungen, macht für Kunisch Sinn. Vor allem, weil Michon nicht darauf verzichtet, noch die Randfiguren, etwa Theodore de Banville, scharf auszuleuchten. Oder auch mal sich selbst, als Helden-Verehrer.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Michons Text ist ein Röntgenbild der modernen französischen Literatur. Zugleich wird der Mythos der Moderne in seiner ganzen Antiquiertheit vorgeführt.« Christian Schärf Frankfurter Allgemeine Zeitung 20081113
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für