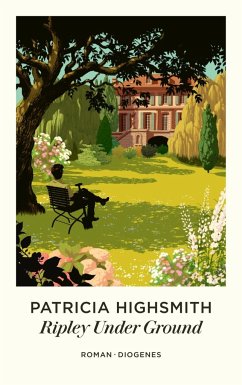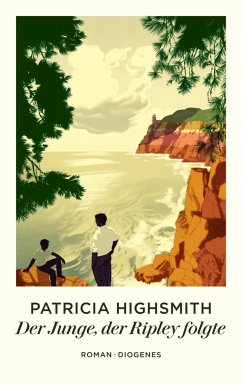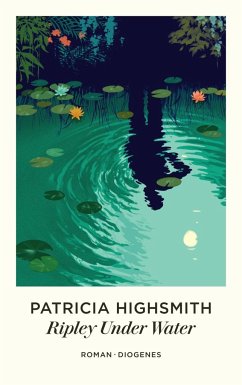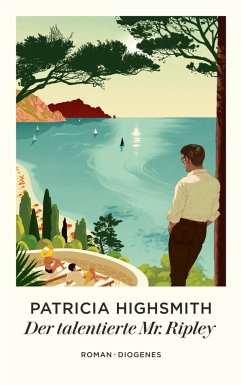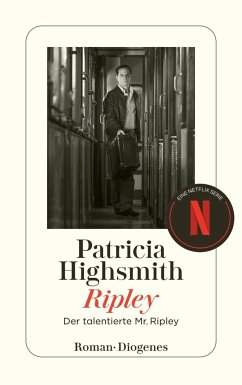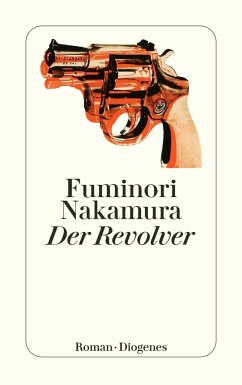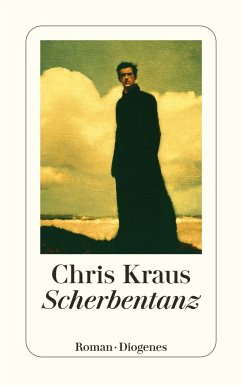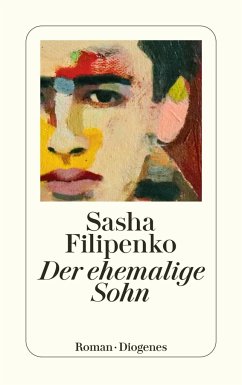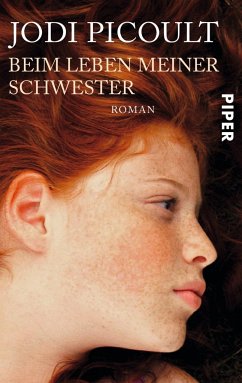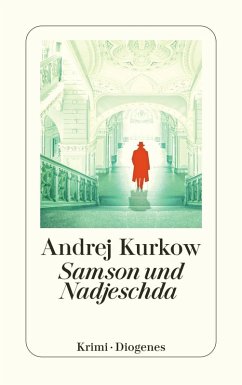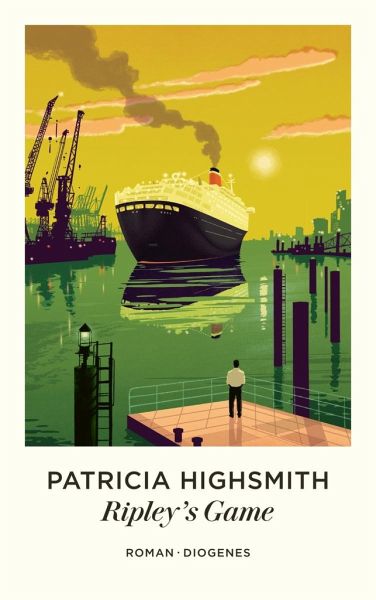
Ripley's Game oder Der amerikanische Freund
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
14,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Tom Ripley ist ein sympathisch-unmoralischer Exil-Amerikaner, der südlich von Paris ein luxuriöses Leben führen will - um jeden Preis. Immer wieder gelingt es dem erfolgreichen Serienhelden, sich vor der Polizei und seinen Verfolgern hakenschlagend aus dem Staub zu machen und dem erwartbaren Verbrecherschicksal eine Nase zu drehen.