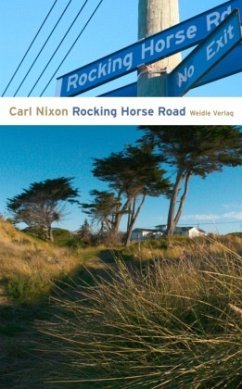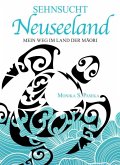Kurz vor Weihnachten 1980 wird die Leiche der 17jährigen Lucy Asher frühmorgens am Strand von The Spit gefunden. In der Mitte dieser schmalen Landzunge vor Christchurch verläuft die Rocking Horse Road. Lucys Eltern haben ein Milchgeschäft an dieser Straße, und Lucy arbeitete oft dort, angeschwärmt von einer Gruppe 15jähriger Jungen. Einer von ihnen findet die Leiche, die anderen sind bald ebenfalls zur Stelle. Lucy wurde erwürgt. Für die Jungen ist damit ihre Kindheit zu einem traumatischen Ende gekommen. Die Suche nach dem Mörder schweißt sie zusammen - über 25 Jahre später sind sie ihm noch immer auf der Spur. Im Jahr nach dem Mord, 1981, macht der Staat Neuseeland eine traumatische Erfahrung: Die Springboks, das südafrikanische Rugby-Team, touren durch das Land. Protest gegen das Apartheidsregime erhebt sich. Es kommt zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. Die Jungen sind Rugby-Fans und erleben das Geschehen hautnah mit: 'Wir hatten das Gefühl, daß da vor unseren Augen etwas sehr Wichtiges zerbrach. Wir konnten es nicht benennen, es war etwas, das uns zuvor selbstverständlich gewesen war und das, wie wir instinktiv wußten, niemals würde repariert werden können.' 'I know you'll never come to harm / Walking down Rocking Horse Road, it's so peaceful' Elvis Costello: Rocking Horse Road (1994)
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Insbesondere die Erzählperspektive von Carl Nixons Roman bewundert Felix Stephan in seiner wohlwollenden Kritik. In einer neuseeländischen Kleinstadt wird eine Schülerin umgebracht, worauf sich eine Gruppe von Jugendlichen daran macht, den Mörder zu finden, fasst der Rezensent zusammen. Hinter der Fassade der Kleinstadt-Normalität werde das Abgründige sichtbar, nicht zuletzt durch das ominöse "Wir", das die Erzählerstimme bilde. Wer sich dahinter verbirgt, ist nicht leicht auszumachen, Stephan vermutet, dass es der "common sense" ist, der sich hier artikuliert. Ein großartiger Einfall, findet der Rezensent, denn dadurch wird die Stimme entindividualisiert und so aus der "individuellen Haftung" entlassen. Auch wenn er Nixon so manches Motiv von Eugenides, David Lynch oder Wes Anderson aufgreifen sieht, fügt sich ihm der Roman doch zum äußerst schlüssigen, sehr spannenden und geradezu "zwangsläufigen" Ganzen. Faszinierend, mit welch leichter Hand der neuseeländische Autor seine Geschichte entspinnt, die auf jeder Seite "vollkommen nachvollziehbar" bleibt, lobt Stephan angetan.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH