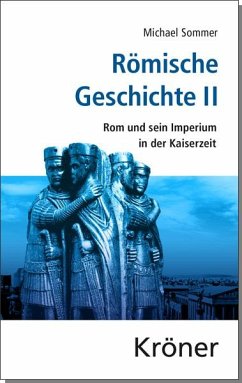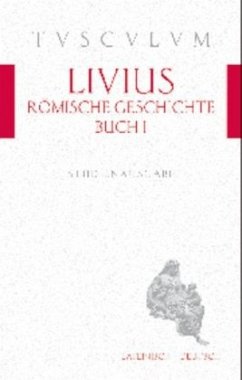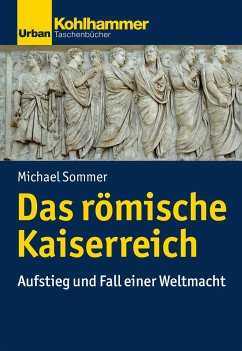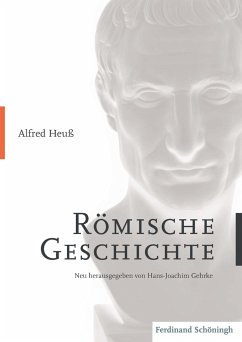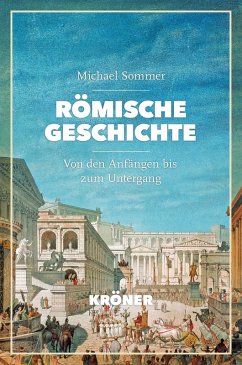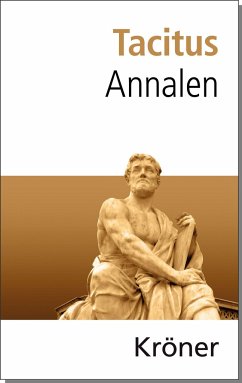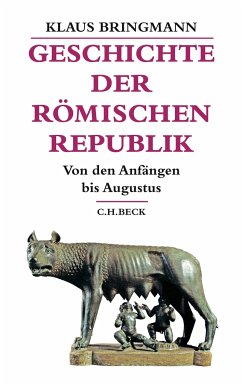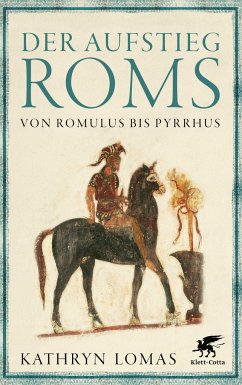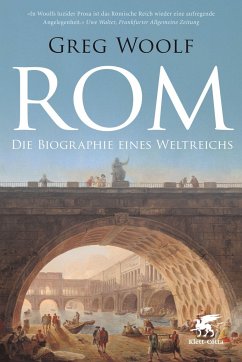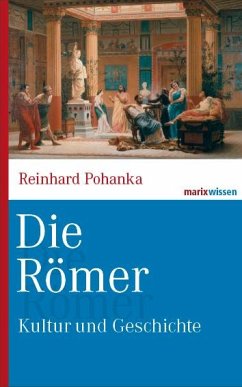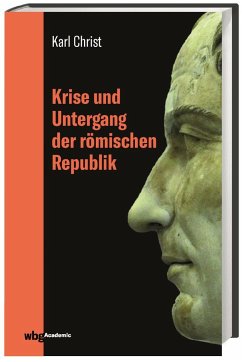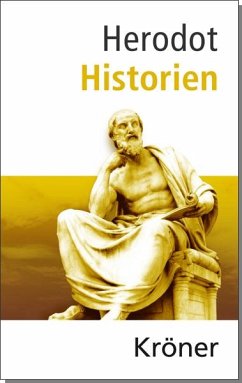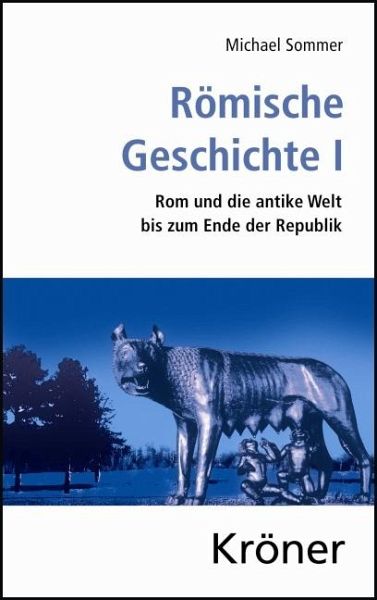
Römische Geschichte I
Rom und die antike Welt bis zum Ende der Republik
Versandkostenfrei!
Verlag / Hersteller kann z. Zt. nicht liefern
30,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:
Rom - das ist für uns die Weltmacht, die ein Reich beherrschte, das sich von den Steppen Asiens bis Gibraltar, von der Irischen See bis ans Rote Meer erstreckte. Rom vollendete die Einheit des Mittelmeerraumes und ließ das nordalpine Westeuropa Anschluss an die mediterrane Zivilisation finden. Doch wie konnte es so weit kommen? Was ermöglichte den beispiellosen Aufstieg Roms von einer kleinen Stadt in Mittelitalien zum Mittelpunkt einer Weltmacht? Und welche Hindernisse stellten sich den Römern auf diesem Weg entgegen?Das Buch spürt den Anfängen der Stadt Rom im von Kriegen und Krisen er...
Rom - das ist für uns die Weltmacht, die ein Reich beherrschte, das sich von den Steppen Asiens bis Gibraltar, von der Irischen See bis ans Rote Meer erstreckte. Rom vollendete die Einheit des Mittelmeerraumes und ließ das nordalpine Westeuropa Anschluss an die mediterrane Zivilisation finden. Doch wie konnte es so weit kommen? Was ermöglichte den beispiellosen Aufstieg Roms von einer kleinen Stadt in Mittelitalien zum Mittelpunkt einer Weltmacht? Und welche Hindernisse stellten sich den Römern auf diesem Weg entgegen?Das Buch spürt den Anfängen der Stadt Rom im von Kriegen und Krisen erschütterten Italien der Eisenzeit nach und es erzählt die aufregende Geschichte einer Gesellschaft, die von den Ständekämpfen bis zu ihrem Zerfall in den Wirren der Bürgerkriege permanent im Umbruch war. Dicht an den textlichen und materiellen Quellen gibt der erste Band dieser Römischen Geschichte Einblick in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft von Romulus bis Augustus. Die Karrieren großer Männer - Scipio Africanus, Marius, Sulla, Pompeius, Caesar und Augustus - tragen ebenso zum Verständnis römischer Geschichte bei wie die zahlreichen Originalzeugnisse, die dieser Band zum Sprechen bringt.