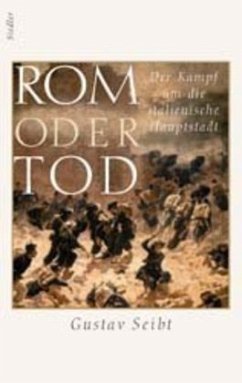Zehn Jahre sind zwischen dem Hauptstadtbeschluss des Parlaments und dem Umzug der Regierung verstrichen: Nicht von Berlin ist die Rede, nicht vom heutigen Deutschland, sondern von Rom und Italien im neunzehnten Jahrhundert. Italien wurde 1861 geeinigt, 1871 bezog es seine Hauptstadt Rom. Es gab lange Hauptstadtdebatten davor und einen ebenso langwierigen Umbau der Stadt danach.Darum hatte es einen Krieg gegeben: Italien hatte die Stadt Rom dem Papst mit militärischen Mitteln entreißen müssen. Und neben dem Krieg der Waffen fanden andere Kämpfe auf den Schlachtfeldern der Presse, der Diplomatie, der Geschichtswissenschaft und der Theologie statt: Gestritten wurde um Fortschritt und Legitimität, Religion und Revolution, Kirche und Nation. Schriftsteller und Gelehrte aus ganz Europa beteiligten sich daran und erörterten dabei Grundsatzfragen der Moderne: nationale Identität, Gewissensfreiheit, Selbstbestimmungsrecht der Völker.Gustav Seibt erzählt die Geschichte dieses vergessenen Kampfes, der damals Millionen Menschen bewegt hat, mit ihren vielfältigen Bezügen und Ebenen: der militärischen, der diplomatischen, der weltanschaulichen und der stadthistorischen. Dabei entsteht ein farbiges Bild vom Übergang Alteuropas zum Europa der Nationen zwischen der Revolution 1848 und den Lateranverträgen 1929. Seibts Buch ist ein Abgesang auf das alte Rom der Päpste und eine Liebeserklärung an das freiheitliche Italien des Risorgimento.

Auch Italien hatte seine Hauptstadtfrage: Gustav Seibt führt den Kampf um Rom und bestaunt die Meinungsschlacht / Von Thomas Brechenmacher
Ein Kampf um Rom" hieß jener 1876 erschienene historische Roman des Professors Felix Dahn, der in über dreißig Auflagen zu einem Kultbuch bürgerlicher Identitätsfindung in der Zeit nach der Reichsgründung wurde. Patriotisches Pathos verband Dahn mit wissenschaftlicher Akribie und packte die Geschichte des vergeblichen Ringens der Ostgoten um die Herrschaft in Italien im sechsten Jahrhundert in die Form eines leidenschaftsgeschwängerten Heldenepos. Ausgerechnet diesen spätantiken Schauplatz zur Projektion und Diskussion der nationalen Thematik zu wählen muß als verfehlt gelten, hinterließ doch der nur wenig spätere Zusammenbruch des Weströmischen Reiches ein Machtvakuum auf der Apenninhalbinsel, das sich erst 1300 Jahre später, im Zuge und mit Hilfe ebender nationalen Bewegung auflöste, deren Zeitgenosse und literarischer Verarbeiter Dahn selbst war.
Diesen anderen, nationalen Kampf um Rom hat nun Gustav Seibt in Szene gesetzt - nicht als Professorenroman, sondern als fachwissenschaftlich fundiertes historisches Sachbuch. Wie Dahn bewegt auch Seibt das Thema der Nation, wenngleich in gänzlich veränderter Perspektive, denn nicht nur der Professorenroman, sondern auch das Nationale hat bekanntlich seine Unschuld längst verloren. Aber genau darum geht es Seibt: sein bildungsbürgerliches Publikum zurückzuführen in die Zeit der überströmenden, naiv-ungebrochenen Kraft des Nationalstaatsgedankens, um zu vermitteln, "was der Nationalismus als positive Gefühlsmacht in aller Unschuld einmal gewesen ist".
Nun feiert dabei Nationalismus jedweder Couleur keineswegs fröhliche Auferstehung; viel eher reflektiert Seibt sein Staunen über die politische Ideen- und Gefühlswelt dieses neunzehnten Jahrhunderts, ein Staunen, das in Zeiten postmoderner Beliebigkeit die Erinnerung an eine Epoche wachrufen will, in der bestimmte Wertvorstellungen die Kraft hatten, Geist und Herz ganzer Gesellschaften zu bewegen. Ungeachtet aller Problematik, die im Grundsätzlichen mit einem derartigen Ansatz verbunden ist, hat Seibt doch aus den möglichen Exempeln für sein Vorhaben das Richtige gegriffen: die der Eroberung Roms durch die Italiener vorausgehende "Meinungsschlacht", "ein Glaubenskrieg, an dem ganz Europa teilnahm, einer der dramatischsten Ideologiekämpfe des revolutionären Zeitalters".
Schon 1861 unter piemontesischer Führung und als Frucht der klugen Politik des Ministerpräsidenten Cavour zum Königreich erhoben, fieberten Italien und mit ihm die Liberalen Europas noch fast zehn weitere Jahre lang der Gelegenheit entgegen, den letzten Schritt zu tun und auch die alte Urbs dem neuen Reich hinzuzufügen, sich selbst die einzig wirklich denkbare Hauptstadt zu geben und sich durch deren welthistorischen Glanz gleichzeitig selbst zu adeln. "Roma o la morte" lautete der Schlachtruf der garibaldinischen Revolutionäre; die Politiker des neuen Königreiches indessen hatten im Gefüge der europäischen Mächtekonstellation vorsichtiger zu agieren und rangen sich noch 1861 nur einen reichlich verklausulierten "Hauptstadtbeschluß" ab.
Ob radikal oder diplomatisch: das Ziel war klar, Vorgehensweise und konkret anzustrebendes Endergebnis blieben umstritten. Denn in Rom saß mit dem Papsttum eine andere, geistlich-religiöse, universale Macht, umgeben von den bröckelnden Resten ihres temporalen Dominiums, des Kirchenstaates, und keineswegs gesonnen, mit den Vertretern des liberalen Nationalstaates auch nur zu verhandeln. Freilich war der Kirchenstaat schon längst auf den Schutz durch einen mächtigen Dritten angewiesen, und so ergab sich die lang ersehnte Chance für Italien erst, als eben jener Dritte, Frankreich, nach der Kriegserklärung an Deutschland im Juli 1870 seine Truppen aus Rom abzog. Nach kurzem Geplänkel mit den päpstlichen Truppen marschierte die italienische Armee am 20. September 1870 durch die Porta Pia in Rom ein, in ihrem Gefolge ein Heer von Berichterstattern, Poeten, jubelnden Intellektuellen und Patrioten.
Aufgehängt an der Hauptstadtfrage, erzählt Seibt die Geschichte der nationalen Einigung Italiens, genauer gesagt drei Geschichten: Schnell im Tempo, reich an Aktionen und nicht ohne Pulverdampf läßt er eingangs die engeren politischen und vor allem dann militärischen Schachzüge bis zur Eroberung Roms Revue passieren; ein zweites Kapitel führt den "Glaubenskrieg" der Jahre 1848 bis 1871 in seiner eher politischen inneritalienischen sowie in seiner eher geschichtsphilosophischen gesamteuropäischen Dimension vor, ehe sich ein drittes Kapitel, "Der Umzug", der Umgestaltung der Stadt zum "italienischen Rom" zwischen 1871 und 1895 widmet. Im Epilog verfolgt Seibt die Konsequenzen dieser Hauptstadtgeschichte über die Lateranverträge von 1929 und die Nachkriegszeit hinweg bis hinein in die unmittelbare Gegenwart der Seligsprechungen Pius' IX. und Johannes' XXIII.
Wohl aus der vermeintlichen Notwendigkeit besonderer Aktualität mußte eine Verbindung zur deutschen Hauptstadtfrage der Jahre nach der Wiedervereinigung hergestellt werden. Das ist legitim, auch aus Vergleichen bezieht Geschichte Leben. Freilich sollte sich der Vergleich dann auch durchführen lassen. Den Kampf um Rom als "die einzige echte historische Parallele zur deutschen Hauptstadtfrage von 1990 bis 1999" ins Bewußtsein zu heben, wie Seibt in der Danksagung als ursprüngliches - und im Laufe der Arbeit vielleicht auch aufgegebenes? - Ziel seines Buches anführt, gelingt nämlich nicht oder höchstens ansatzweise im dritten Kapitel.
Seibt argumentiert insgesamt gut informiert, ausgewogen, differenziert und höchst anschaulich. Weit davon entfernt, sich zum bedingungslosen Anwalt des Nationalstaatsgedankens aufzuschwingen, zeigt er die vielschichtigen Facetten seines Sujets durchaus auf. Daß die Nationalbewegung per se, nur weil die populärere, fortschrittlichere, zeitgemäßere, auch die legitimere Bewegung war, ist für ihn keineswegs ausgemacht; daß die Usurpation des Kirchenstaats ein klarer Rechtsbruch war, bleibt unbestritten. Natürlich: die Triebkraft der Idee spülte letztendlich derartige Skrupel leichthändig weg.
Selbst der besonnene Seibt bleibt bei seiner Quellenlektüre davon nicht immer unbeeindruckt, läßt sich vom Pathos seiner liberalen Gewährsleute auch schon einmal mitreißen, so daß mitunter der Eindruck entsteht, die Ideologie allein hätte schon genügt, die Verhältnisse in Italien umzustürzen. Aus der Distanz einer universalhistorischen Perspektive hätte er streckenweise noch stärker entgegenhalten können, daß es doch nicht um einen Gegensatz zwischen alten überlebten und neuen, so viel leistungsfähigeren Modellen ging, sondern um die Auflösung des tausend Jahre alten Machtvakuums in der Mitte Europas. Wäre die Staatenordnung von 1648 und 1815 wirklich in der Lage gewesen, dieses Machtvakuum unter Kontrolle zu halten, hätte auch die liberale Nationalbewegung letztlich dagegen nichts ausrichten können. Cavour nicht weniger als Bismarck bewegte als Realpolitiker in der Stunde des Versagens der alten Ordnung die Möglichkeit einer grundlegenden machtpolitischen Neuordnung, für die sie die Nationalstaatsbewegung als treffliches Vehikel nutzen konnten.
Sehr plastisch arbeitet Seibt den aus dem Kampf um Rom resultierenden Identitätszwiespalt der Italiener zwischen nationaler und katholischer Orientierung heraus und zeigt dessen fatale Folgen für den italienischen Staat bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein auf. War daran allein die konsequente Verweigerungshaltung der Kurie gegenüber dem Nationalstaat schuld? Wenn Seibt verschiedentlich durchblicken läßt, welche Lösungen dieses Spannungsverhältnisses seiner auktorialen Vernunft entsprechend wünschenswert gewesen wären, begibt er sich freilich in die Gefahr, anachronistisch zu denken. Rational sprach sicherlich viel für Cavours noch auf dem Totenbett geäußerten Plan einer "libera chiesa in libero stato". Dahinter stand das Argument, die Kurie sei doch längst nicht mehr frei in ihrem Rumpfstaat, sondern vom Willen Dritter abhängig gewesen und hätte im Gegensatz dazu als vom Nationalstaat garantierte unabhängige Institution an Freiheit sogar noch gewonnen. Pius IX. und seinem Kardinalstaatssekretär Antonelli hier Kurzsichtigkeit und Unvernunft zu attestieren geht aber denn doch am Verständnis der kurialen Gedankenwelt vorbei. Ein wie auch immer geartetes Bündnis mit der "Moderne" war dem Heiligen Stuhl in seiner defensiven Situation schlicht unmöglich, Vernunft hin oder her.
Überhaupt scheint bei allen Bemühungen Seibts um die ideologischen Debatten die Beschäftigung mit der Lebenswirklichkeit im Kirchenstaat in den letzten Jahrzehnten seines Bestehens etwas kurz gekommen zu sein. Pauschal die Überlebensunfähigkeit dieses Staatswesens festzustellen befriedigt wenig; die Wirklichkeit war wesentlich komplexer, wie - um nur einen deutschen Forscher zu nennen - Christoph Weber in zahlreichen Arbeiten vorgeführt hat. So charakterisiert beispielsweise das schauerlich-romantische Genrebild des römischen Ghettos jüdische Existenz im Kirchenstaat nur sehr fragmentarisch und gibt als solches doch allenfalls einen vagen Hinweis auf die innere Beschaffenheit des Stato Pontificio. Schließlich konnte sich Seibt im Epilog auch eines Werturteils über Pius XII. nicht entschlagen; statt flott hinzuformulieren, dieser habe angesichts der nationalsozialistischen Judenverfolgung "jenen großen welterschütternden Protest" vermieden, "welcher der auch theologischen Unheilsdimension dieses Vorgangs angemessen gewesen wäre", wäre es jedenfalls für Seibt besser und auch der sonstigen Qualität seines Buches angemessen gewesen, sich zunächst mit dem Stand der seriösen Forschung zu dieser Thematik vertraut zu machen.
Gustav Seibt hat eine bekannte Geschichte in anregender Perspektive neu erzählt. Den Bürgern einer wiedervereinten Nation mit einer ihnen wieder zugewachsenen Hauptstadt hält sein bemerkenswertes Buch den Spiegel einer anderen (nicht parallelen) Hauptstadt- und Einigungsgeschichte vor. Nicht Identitätsmythen wie weiland Dahn, sondern historische Bausteine für das Nachdenken über Identität stellt Seibt bereit. Ob diesem Versuch dreißig Auflagen beschieden sein können, wird fraglich sein, aber viele Leser möchte man ihm gleichwohl wünschen.
Gustav Seibt: "Rom oder Tod". Der Kampf um die italienische Hauptstadt. Siedler Verlag, Berlin 2001. 351 S., Abb., geb., 49,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Die Geschichte Roms ist untrennbar mit der Herrschaft des Vatikans verbunden, schreibt Thomas Meyer und zeigt sich hellerfreut darüber, dass zwei neue Studien, die der Rezensent beide für brillant hält, mehr Licht ins Dickicht der päpstlichen Machtstrukturen bringen. Und das aus unterschiedlichen Perspektiven. Arne Karsten geht ins Detail, er gibt Einblick in das Leben des Kardinals Bernardino Spada, Gustav Seibt bleibt auf der sozialen Ebene und klärt den Leser über die Welt- und Heilsgeschichte des 19. Jahrhunderts auf, informiert der Rezensent.
1) Arne Karsten: "Kardinal Bernardino Spada"
Der junge Berliner Kunsthistoriker Karsten hat Glück gehabt und die bisher unbekannten Konvolute des Kardinal-Bruders Virgilio entdeckt, der der Nachwelt eine detailreiche und ironische Biografie über Bernardino Spada hinterlassen habe, so Meyer. Karsten hat daraus, lobt der Rezensent, ein "glanzvolles Porträt" des barocken Roms gemacht, das intellektuell umsichtig über die komplizierte Aufgeladenheit der Diplomatensprache und die Symbolik von Geschenken, Bildern und Grabstätten informiere, ohne eine kritische Distanz zur Vorlage von Virgilio zu verlieren. Der Kardinal jedenfalls wusste seine Karriere zu stricken, das zeitgenössische Glasperlenspiel zu spielen. Bildung und Gespür für die Situation ließen ihn an seiner jeweiligen Position feilen, auch wenn es ihm letztlich nicht gelang, berichtet Meyer, als Papst an die Spitze des Vatikans zu treten.
2) Gustav Seibt: "Rom oder Tod"
Bei dem Historiker und Publizisten Gustav Seibt geht es allgemeiner zu, wenngleich auch er die Strukturen durchleuchtet, hier aber nicht die der Individuen, sondern die von Rom im Strudel des europäischen Nationalisierungsprozesses sowie des Spannungsverhältnisses zwischen Kirche und Staat im 19. Jahrhundert, so der Rezensent. Ganz begeistert zeigt sich Meyer über Seibts Fähigkeit, dieses Verhältnis auf drei Ebenen gleichermaßen kompetent zu analysieren, nämlich auf der europäischen, der weltanschaulichen und der ästhetischen. Das Buch ist, lobt der Rezensent, "faszinierend", ein Lehrstück über den Kampf - des Katholizismus, Liberalismus, Patriotismus und später Mussolinis Faschismus - um die Vorherrschaft in Rom.
© Perlentaucher Medien GmbH
1) Arne Karsten: "Kardinal Bernardino Spada"
Der junge Berliner Kunsthistoriker Karsten hat Glück gehabt und die bisher unbekannten Konvolute des Kardinal-Bruders Virgilio entdeckt, der der Nachwelt eine detailreiche und ironische Biografie über Bernardino Spada hinterlassen habe, so Meyer. Karsten hat daraus, lobt der Rezensent, ein "glanzvolles Porträt" des barocken Roms gemacht, das intellektuell umsichtig über die komplizierte Aufgeladenheit der Diplomatensprache und die Symbolik von Geschenken, Bildern und Grabstätten informiere, ohne eine kritische Distanz zur Vorlage von Virgilio zu verlieren. Der Kardinal jedenfalls wusste seine Karriere zu stricken, das zeitgenössische Glasperlenspiel zu spielen. Bildung und Gespür für die Situation ließen ihn an seiner jeweiligen Position feilen, auch wenn es ihm letztlich nicht gelang, berichtet Meyer, als Papst an die Spitze des Vatikans zu treten.
2) Gustav Seibt: "Rom oder Tod"
Bei dem Historiker und Publizisten Gustav Seibt geht es allgemeiner zu, wenngleich auch er die Strukturen durchleuchtet, hier aber nicht die der Individuen, sondern die von Rom im Strudel des europäischen Nationalisierungsprozesses sowie des Spannungsverhältnisses zwischen Kirche und Staat im 19. Jahrhundert, so der Rezensent. Ganz begeistert zeigt sich Meyer über Seibts Fähigkeit, dieses Verhältnis auf drei Ebenen gleichermaßen kompetent zu analysieren, nämlich auf der europäischen, der weltanschaulichen und der ästhetischen. Das Buch ist, lobt der Rezensent, "faszinierend", ein Lehrstück über den Kampf - des Katholizismus, Liberalismus, Patriotismus und später Mussolinis Faschismus - um die Vorherrschaft in Rom.
© Perlentaucher Medien GmbH