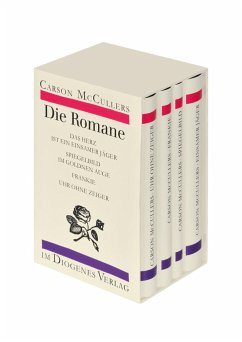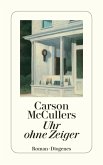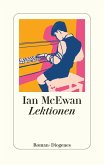Carson McCullers - Die Romane In revidierter Übersetzung und in der Lieblingsausstattung von Carson McCullers »Was bleibt, ist ihr Werk, es ist unvergänglich.« Neue Zürcher Zeitung »Jeder sollte Carson McCullers lesen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die große Südstaaten-Dichterin Carson McCullers kann uns heute noch aufrütteln. Das beweist eine exzellente Neuausgabe ihrer großen Romane.
Von Daniel Haas
Kennen wir diese Rede nicht von den Demonstranten der Occupy-Wallstreet-Bewegung? "In unserem Land herrscht ein großes, wahres Prinzip, nämlich Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit", ruft der wütende Mann. "Und was ist daraus geworden? Auf der einen Seite milliardenschwere Konzerne - auf der andern Seite Hunderttausende, die nichts zu essen haben." Nun aber ist die Zeit der Aufklärung gekommen: "Der Wissende sieht, wie das Kapital und die Macht langsam eins wurden. Er sieht das ganze verdammte Heer von Arbeitslosen und sieht, wie Milliarden von Dollars vergeudet werden. Er sieht, dass die Menschen vor lauter Leid gemein und hässlich werden und dass irgendwas in ihnen abstirbt."
Die Stimme dieses Wissenden war nicht in Manhattan zu hören. Sie stammt aus dem amerikanischen Süden, schon lange hallt sie durch die Literaturgeschichte. Es sind die Worte von Jake Blount, dem unheiligen Trinker aus dem Roman "Das Herz ist ein einsamer Jäger". Das Debütwerk von Carson McCullers erschien 1940; Amerika kämpfte mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise, die Reformen des New Deal sorgten zwar für Konsolidierung, eine wirkliche Umverteilung des Reichtums aber fand nicht statt. Roosevelt selbst sagte, seine Regierung habe das System privaten Profits und freien Unternehmertums gerettet. Kein Wunder, dass "Monopoly" das Brettspiel der Dekade war.
Nun wird wieder kräftig gezockt und geschachert, und im grellen Licht der aktuellen Lage kann man McCullers in neuer Weise lesen, als eminente Kritikerin gesellschaftlicher Strukturen. Als ihr Werk zu Beginn der fünfziger Jahre erstmals in deutscher Übersetzung erschien, war man hierzulande auf Hemingway und Steinbeck fixiert; es musste ein bisschen markiger sein, handlungsorientierter. McCullers empfand man als zu leise, zu lyrisch. Dann setzten sich prominente Leser wie Heinrich Böll und Horst Bienek für sie ein. Letzterer schwärmte: "Sie behandelt einen Stoff, bis er an den Rand seiner Aussagekraft getrieben wird." Das stimmt. Heute, in Zeiten der transatlantischen Katastrophen, erreicht uns der "Jäger"-Roman mit der Wucht der politischen Streitschrift. Das liegt auch an seinem zweiten Sujet: Rassismus und wie er eine Nation kulturell aushöhlt und zerstört.
In der vollständig überarbeiteten Übertragung ist der klare Ton von McCullers nun besser vernehmbar. Die geschraubte Syntax älterer Übersetzungen weicht einer schlanken, eleganten Diktion. So zeigt sich noch deutlicher, dass in diesen Erzähldramen das Persönliche immer auf gesellschaftliche Regeln bezogen ist. Man tut McCullers unrecht, wenn man sie ausschließlich als Symbolistin verehrt, die den Menschen als zwischen Lust und Gewalt gestelltes Rätsel entwirft. Das gilt auch für die Darstellung der Pubertät, einem wesentlichen Thema dieses Romanwerks. Adoleszenz ist für McCullers dabei weniger das Feld zur Erprobung psychologisch-darstellerischer Finessen als eine kritisch aufzuladende Konstruktion. Im "Jäger"-Roman lernen wir Mick kennen. Die Dreizehnjährige leidet am ideologischen Mief der Zeit. Mick hört Beethoven, spart für Klavierstunden, die Kunst könnte ein Ausweg sein. Aber wie gnadenlos McCullers diesen Menschen zurückzwingt in die Verhältnisse! An der Kasse von Woolworth endet der Traum vom musikalischen Virtuosentum.
Mit Frankie, der Heldin des gleichnamigen, 1946 erschienenen Buches, erhielt Mick eine Schwester im Geiste. Das Werk galt als sensationell: Anhand einer einzigen Mädchenfigur wesentliche Daseinsfragen darzustellen, das war neu. Die Verlorenheitsgefühle der Pubertät, das Empfinden des Anders- und Fremdseins, all dies wird in kammerspielartiger Intensität gezeigt. Aber auch hier ein über die Seelenkunde hinausgehender Blick: Frankie, androgyn, launenhaft, begeistert von Jazzmusik und Literatur, ist ein utopischer Typus. Als Wanderin zwischen der vergehenden Kindheit und dem aufziehenden Erwachsenenalter ist sie ein Wesen der Differenz, belegt mit dem Fluch, überall und nirgends zu Hause zu sein. Ihre Gefühlswallungen sind mehr als nur die theatralischen Posen der Jugend, sie belegen ein Gespür für die Verlorenheit des verwalteten Menschen. "Die Welt kam ihr riesig vor, rissig und wackelig. Am liebsten würde sie die ganze Stadt niederreißen." Ist das nicht auch der Traum des Anarchisten, der den Glauben an die Erneuerung der Gesellschaft aus sich selbst heraus aufgegeben hat? Frankie wird dieses Begehren nach dem Anderen verlieren und zur kichernden Göre werden. Es gibt auch hier kein Peter-Pan-Glück, sondern nur das Beruhigende der Konvention, das immer auch eine Beschämung ist.
Man hat in den beiden Mädchengestalten Widergängerinnen der Autorin erkannt. Carson McCullers wollte Musik studieren und verließ dafür im Alter von siebzehn ihren Heimatort Columbus in Georgia. Dass ihr in New York eine Freundin angeblich das letzte Geld für Klavierstunden klaute, ist ein schöner Gründungsmythos dieser Literatur, und wir, die Leser, sind der Diebin dankbar.
Die Musik wandelte sich in der Folge zum Motiv, mit der sich Konflikte illustrieren ließen, am eindrucksvollsten im letzten Roman, "Uhr ohne Zeiger". Da drischt Sherman, ein schwarzer Dienstbote, auf ein Klavier ein und erklärt: "Ich vibriere bei jeder Ungerechtigkeit, die meiner Rasse angetan wird. Ich vibriere, vibriere und vibriere." Es ist eine fatale Schwingung, die hier einsetzt, denn der Junge muss für seinen weißen Arbeitgeber rassistische Briefe schreiben. Das Buch erschien 1961 in Amerika, im selben Jahr stürmten Weiße in Alabama eine Kirche, um eine Predigt von Martin Luther King zu verhindern. Ein Jahr später kam es zu Krawallen, weil sich ein Schwarzer an der Universität von Mississippi einschreiben wollte.
McCullers war zu diesem Zeitpunkt bereits eine Legende, todkrank und literarisch unsterblich. "Uhr ohne Zeiger" ist deshalb auch eine autobiographische Reflexion: Im Zentrum des Buches steht der Apotheker Malone; er wird an Leukämie sterben, und wie die pubertierenden Heldinnen schreitet er die Grenzen zwischen Seinsbereichen ab. Erschütternde Lektion des Texts: Selbst die Tiefe der Sterbenserfahrung kann die etablierte Ordnung nicht erschüttern, noch auf dem Sterbebett löst die Nachricht von der Aufhebung der Rassentrennung Bestürzung aus.
Carson McCullers verwendet das Todesmotiv nicht als Ausrufezeichen, sondern als Gedankenstrich. Mit welcher Lakonie sie Akteure vom Schachbrett ihrer Geschichten räumt, das ist schockierend. Der radikalste Text in dieser Hinsicht ist "Spiegelbild im goldenen Auge". In einer Garnison geschieht ein Mord, "an dieser Tragödie waren beteiligt: zwei Offiziere, ein Soldat, zwei Frauen, ein Filipino und ein Pferd". So beginnt das komplexe Drama um heimliche Lust und sozialen Dünkel, verleugnete Homosexualität und seelische Grausamkeit. Auch diesen Text darf man nicht herauslösen aus unserem Zeithorizont; er ist eine messerscharfe Inspektion einer Männergesellschaft, wo Liebe und Eros durch Machtstrukturen gelenkt werden. Erlösung gibt es auch diesmal keine, McCullers ist schonungslos in Fragen der Metaphysik. "Über Jesus hatte sie gehört, dass er einmal irgendwo auf einem Esel geritten war", heißt es von der Frau jenes Majors, dessen Affäre für alle zum Verhängnis werden wird. "Aber wer ritt schon freiwillig auf einem Esel?"
Der kürzlich verstorbene Diogenes-Verleger Daniel Keel hatte sich diese Ausgabe gewünscht, gegen den Willen so mancher Verlagskollegen. Es gäbe doch gar kein Jubiläum, hieß es, oder sonst einen offiziellen Anlass. Jetzt ist diese wunderbare Edition da, und Keel behält wieder einmal recht: Carson McCullers braucht den Kalender nicht. Ihr Werk beglaubigt sich durch Zeitgebundenheit über die Zeiten hinweg, durch seine aus der Geschichte herandrängende Aktualität.
Carson McCullers: "Die Romane".
In revidierter Übersetzung von Elisabeth Schnack, Susanna Brenner- Rademacher, Richard Moering. Diogenes Verlag, Zürich 2011. 4 Bde., 1488 S., 69,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Sehr dankbar ist Rezensent Daniel Haas dem verstorbenen Verleger Daniel Keel, dass er sich für eine überarbeitete Neuedition der Romane von Carson McCullers eingesetzt hat. Denn man kann im vorliegenden Band nicht nur die Entdeckung machen, dass die Romane der Südstaaten-Autorin erstaunlich aktuell sind in der Kritik gesellschaftlicher Strukturen. Die überarbeitete Übersetzung findet auch einen klaren, "eleganten" Duktus, wie der Rezensent zufrieden bemerkt, mit der die Autorin aus der symbolistischen Ecke, in die sie gern gestellt wurde, ein Stück weit herausgeholt wird. Schon im Debütroman, "Das Herz ist ein einsamer Jäger" von 1940, findet Haas Sätze, die so auch direkt von Anhängern der Occupy-Wallstreet-Bewegung gesagt werden könnten und deshalb liest man ihren Romanen heute die "Wucht der politischen Streitschrift" ab, wie der Rezensent meint. Neben der Kritik von Kapitalismus und Rassismus ist es vor allem die "Verlorenheit des verwalteten Menschen", die McCullers in ihren Romanen thematisiert, so Haas. Er glaubt, dass ihre Romane eine "aus der Geschichte herandrängende Aktualität" besitzen, die sie auch behalten werden und nicht zuletzt deshalb findet er diese Neuausgabe einfach "wunderbar".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Jeder sollte Carson McCullers lesen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung