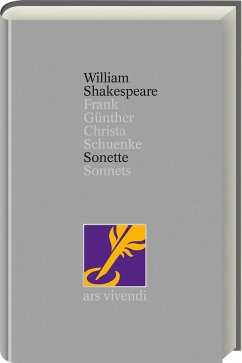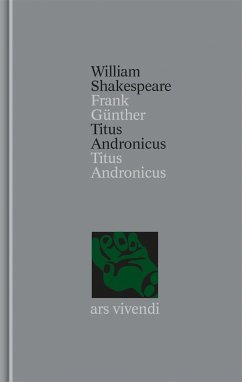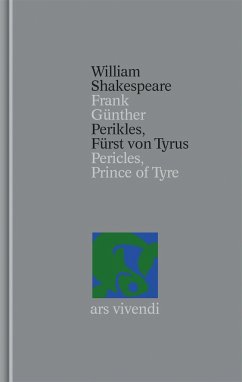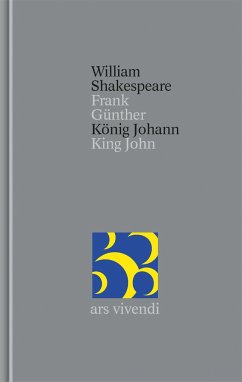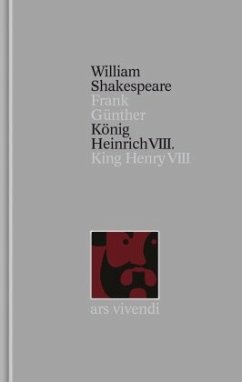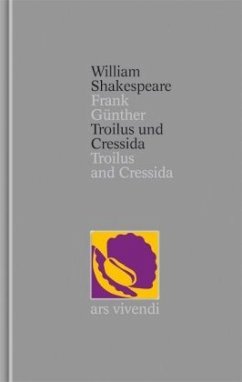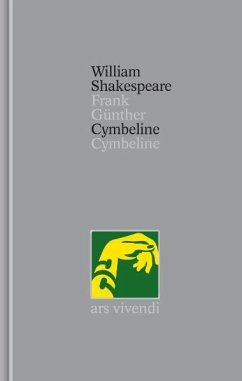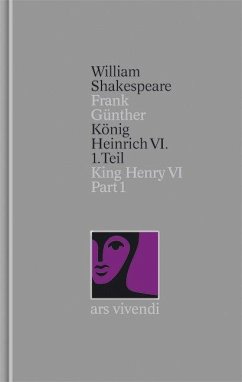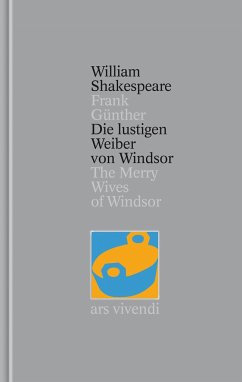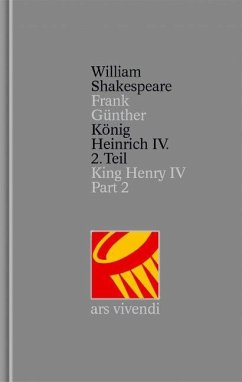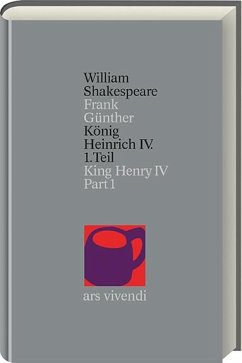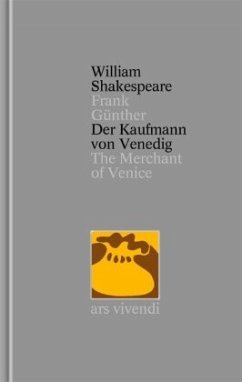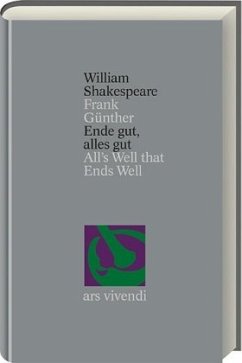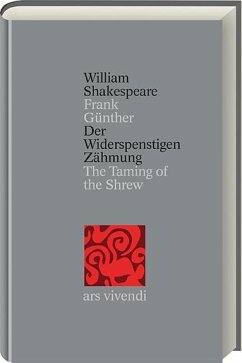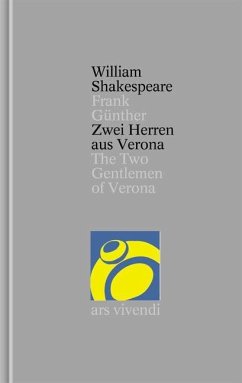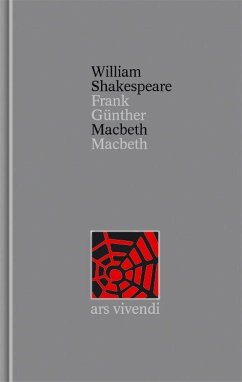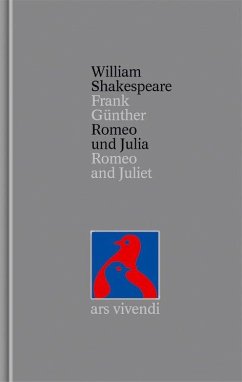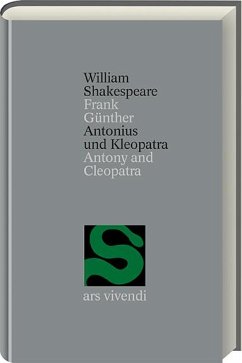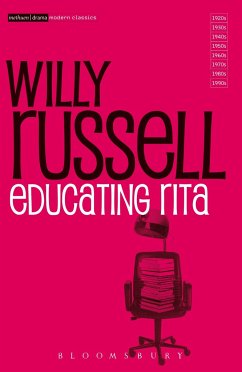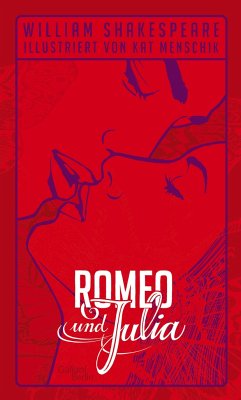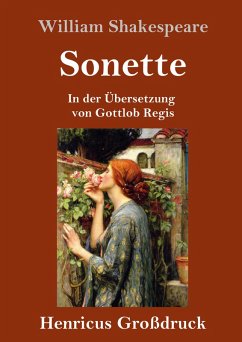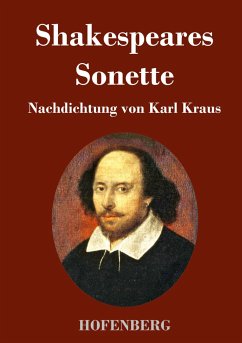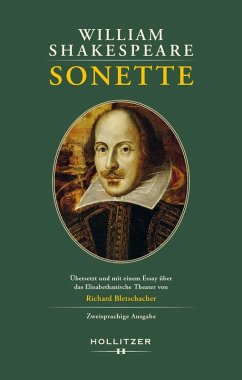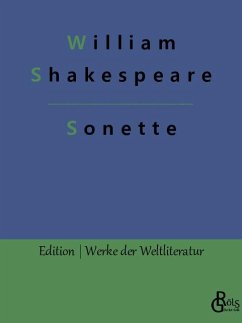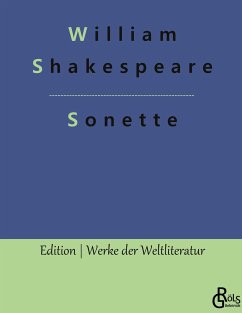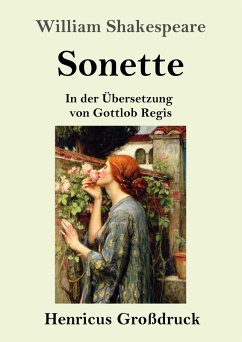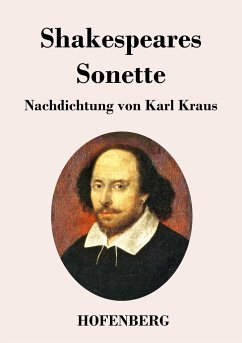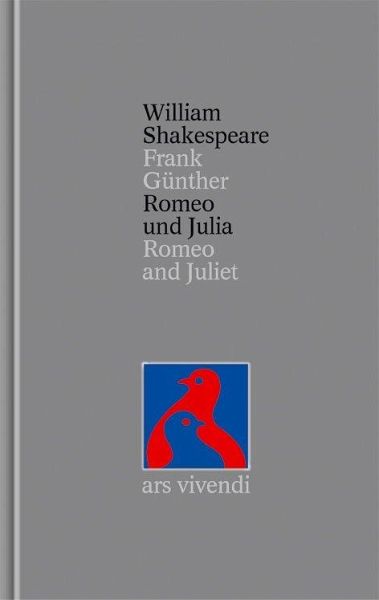
Romeo und Julia / Shakespeare Gesamtausgabe Bd.5
(Gesamtausgabe, 5)
Übersetzung: Günther, Frank; Günther, Frank
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Band 5. Tragödie.Zwei angesehene Familien in Verona, die Montagus und die Capulets, sind seit Jahren verfeindet. Da es immer wieder zu Tätlichkeiten zwischen ihnen kommt, verhängt Fürst Escalus strenge Strafen über denjenigen, der den von ihm mühsam gestifteten Frieden bricht. Romeo, der Sohn Montagus, wird mit seinem Freund Mercutio irrtümlich zu einem Maskenfest der Capulets eingeladen. Dort begegnet er Julia, der Tochter der Capulets. Vergessen ist Rosalinde, die Romeo eben noch unglücklich anschwärmte, vergessen ist Graf Paris, mit dem Julia verheiratet werden soll - die beiden ve...
Band 5. Tragödie.Zwei angesehene Familien in Verona, die Montagus und die Capulets, sind seit Jahren verfeindet. Da es immer wieder zu Tätlichkeiten zwischen ihnen kommt, verhängt Fürst Escalus strenge Strafen über denjenigen, der den von ihm mühsam gestifteten Frieden bricht. Romeo, der Sohn Montagus, wird mit seinem Freund Mercutio irrtümlich zu einem Maskenfest der Capulets eingeladen. Dort begegnet er Julia, der Tochter der Capulets. Vergessen ist Rosalinde, die Romeo eben noch unglücklich anschwärmte, vergessen ist Graf Paris, mit dem Julia verheiratet werden soll - die beiden verlieben sich leidenschaftlich ineinander. Sie schwören einander ewige Liebe und lassen sich heimlich von dem Franziskanerpater Lorenzo trauen, der sich von dieser Ehe eine Versöhnung der feindlichen Familien erhofft. Bei einem zufälligen Zusammentreffen auf der Straße beleidigt Tybalt, ein Vetter Julias, Romeo, um ihn zum Kampf zu reizen. Mercutio greift anstelle des Freundes zum Degen und wird durchRomeos Schuld, der zwischen die Kämpfenden tritt, tödlich verwundet, woraufhin Romeo Tybalt ersticht. Der Prinz verbannt den vermeintlichen Friedensbrecher aus Verona. Die letzte Nacht vor der Flucht nach Mantua verbringt Romeo bei Julia - es ist ihre Hochzeitsnacht. Als die Capulets Julia zur Ehe mit Paris zwingen wollen, bittet die Verzweifelte Pater Lorenzo um Hilfe, der eine List ersinnt: Julia soll durch einen Trank in einen todesähnlichen Schlaf versenkt werden und dann aus der Gruft mit Romeo nach Mantua fliehen. Doch die Nachricht von dem Plan erreicht Romeo nicht. Er erfährt nur, dass Julia tot sei, und eilt nach Verona. Vor Julias Gruft stößt er auf Paris, den er im Zweikampf tötet. Dann nimmt er Gift und stirbt an Julias Seite. Als Julia erwacht und den leblosen Geliebten sieht, folgt sie ihm in den Tod. Über den Leichen ihrer Kinder reichen sich die Väter, von Pater Lorenzo über das tragische Geschick der Liebenden aufgeklärt, zum Zeichen der Versöhnung die Hände.Shakespeare hat mit seiner traurig-zufälligen Fabel von Romeo und Julia einen Liebesmythos geschaffen, ein Urbild der Liebe. Zwei junge Menschen finden sich in der Fähigkeit, sich ganz dem großen Gefühl hinzugeben, und in dem Willen, ihre Liebe gegen alle Widerstände durchzusetzen. Die Welt ist grausam für wahre Liebende. Das Scheitern des absoluten Gefühls in einer engstirnigen und hasserfüllten Umgebung erscheint ebenso zufällig wie folgerichtig. Von Anbeginn begleitet diese Liebe die Ahnung des Todes. Eine tragische Ahnung, dass in dem Aufgehen im Absoluten einer solchen Liebe auch ihr Untergang beschlossen ist, dass alle große Liebe zugleich eine Liebe in Todesnähe ist. Romeos und Julias Liebe erfüllt sich in einer einzigen Nacht und wird durch den Tod unsterblich.Zweisprachige Ausgabe mit Anmerkungen des Übersetzers, Bericht aus der Übersetzerwerkstatt und einem einführenden Essay von Kurt Tetzeli v. Rosador.Sprachen: Deutsch, Englisch
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote