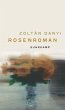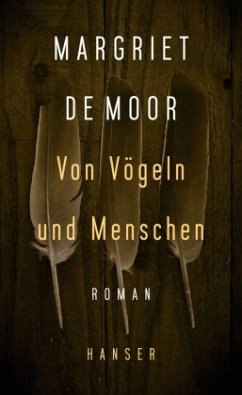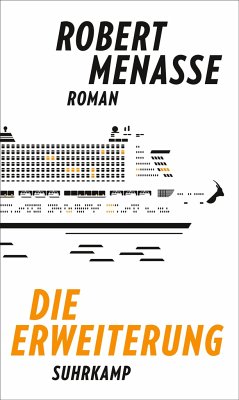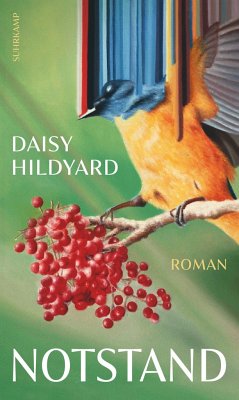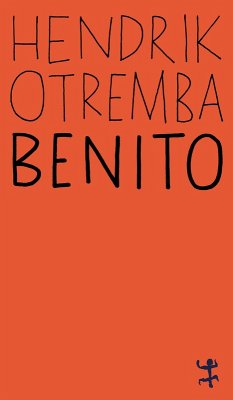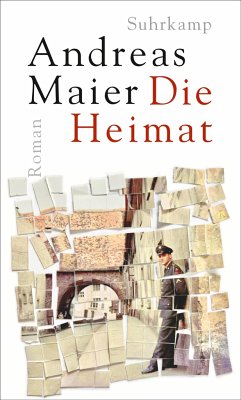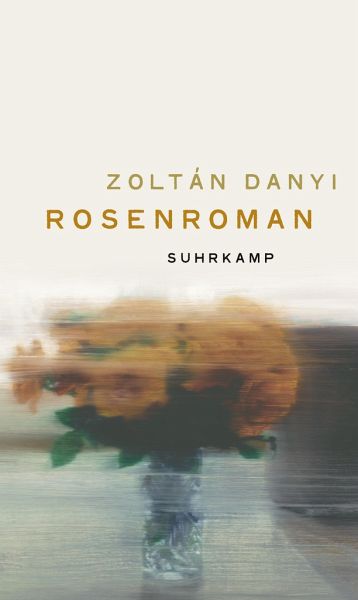
Rosenroman
Roman
Übersetzung: Mora, Terézia

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Ich stand am Fenster und wartete, dass die Sonne unterging, denn das war die Regel, und wenn ich nicht wollte, dass etwas Schlimmes geschah, musste ich warten, bis sie untergegangen war.«Mit diesen Sätzen beginnt er, der Lebensbericht eines Erzählers, der nach einer existenziellen Krise in seine serbische Heimatstadt zurückgekehrt ist - von der belgischen Nordseeküste an die Theiß, aus Westflandern unter den hohen leeren Himmel der Vojvodina. Die Handlung umfasst drei Jahrzehnte, vom Beginn der Jugoslawienkriege bis in die Gegenwart.Dem Kriegsdienst entgangen, arbeitet er auf der Rosen...
»Ich stand am Fenster und wartete, dass die Sonne unterging, denn das war die Regel, und wenn ich nicht wollte, dass etwas Schlimmes geschah, musste ich warten, bis sie untergegangen war.«
Mit diesen Sätzen beginnt er, der Lebensbericht eines Erzählers, der nach einer existenziellen Krise in seine serbische Heimatstadt zurückgekehrt ist - von der belgischen Nordseeküste an die Theiß, aus Westflandern unter den hohen leeren Himmel der Vojvodina. Die Handlung umfasst drei Jahrzehnte, vom Beginn der Jugoslawienkriege bis in die Gegenwart.
Dem Kriegsdienst entgangen, arbeitet er auf der Rosenfarm seines Vaters. Trotz eines Handelsembargos transportiert er die Pflanzen ins europäische Ausland, die Angst mit selbstgesetzten Regeln bekämpfend. Jahre später werfen ihn eine schwere Krankheit und eine Beziehungskrise aus der Bahn.
Mit bezwingender sprachlicher Schönheit, in seiner Ruhe und unerhörten Intensität einem Werk der Minimal Music vergleichbar, vollzieht Zoltán Danyis meisterhafter Roman die seelische und physische Selbsterforschung eines Menschen nach, der sich schreibend aus der Sackgasse seines Lebens herausarbeitet.
Mit diesen Sätzen beginnt er, der Lebensbericht eines Erzählers, der nach einer existenziellen Krise in seine serbische Heimatstadt zurückgekehrt ist - von der belgischen Nordseeküste an die Theiß, aus Westflandern unter den hohen leeren Himmel der Vojvodina. Die Handlung umfasst drei Jahrzehnte, vom Beginn der Jugoslawienkriege bis in die Gegenwart.
Dem Kriegsdienst entgangen, arbeitet er auf der Rosenfarm seines Vaters. Trotz eines Handelsembargos transportiert er die Pflanzen ins europäische Ausland, die Angst mit selbstgesetzten Regeln bekämpfend. Jahre später werfen ihn eine schwere Krankheit und eine Beziehungskrise aus der Bahn.
Mit bezwingender sprachlicher Schönheit, in seiner Ruhe und unerhörten Intensität einem Werk der Minimal Music vergleichbar, vollzieht Zoltán Danyis meisterhafter Roman die seelische und physische Selbsterforschung eines Menschen nach, der sich schreibend aus der Sackgasse seines Lebens herausarbeitet.