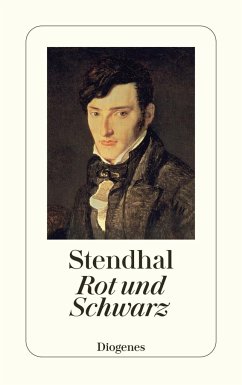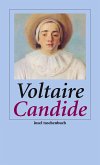Julien Sorel, die Hauptfigur dieses Romans, verkörpert die revolutionäre Gesinnung des jungen Stendhal, dessen Widerstand gegen Zeit und Gesellschaft ihn zur Tartüfferie zwingt, wie auch seinen Hass gegen Klerus und Monarchie. Julien ist darüber hinaus Ausdruck jener Lebensanschauung, die die 'Jagd nach dem Glück', die Erfüllung des Strebens nach Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung großangelegter Naturen jenseits einengender moralischer Schranken postuliert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Eine Seele unter Hochdruck: Stendhals "Rot und Schwarz", endlich adäquat übersetzt
Vorsicht, explosiv! müßte man diesem Helden, der wirklich einer ist, als Warnhinweis mitgeben. Der Zimmermannssohn Julien Sorel, eine der legendären Romanfiguren des neunzehnten Jahrhunderts, ist eine großangelegte Natur in kleiner Zeit, ein prächtig begabter, aber zugleich unterdrückter Mensch, verwundet im Selbstbewußtsein. Überall wittert er Kränkung und Verspottung; ein falscher Blick genügt, um ihn in flammende Kampfbereitschaft zu versetzen. Am Anfang des Romans steht eine Demütigungsszene, die man sich stellvertretend für viele zu denken hat. Der ungeliebte Vater erwischt Julien bei der Lektüre (Napoleon, versteht sich) und schlägt ihm wütend das Buch aus der Hand.
Unter Zähneknirschen lernt der junge Mann die gesellschaftliche Mimikry, leistet die Herkulesarbeit der Verstellung. Da im Frankreich der tiefsten Restauration - die Handlung beginnt im Jahr 1826 - Karrieren in Militär und Staatsdienst wieder dem Adel vorbehalten sind, setzt sich sein Machtwille die klerikale Maske auf. Was bleibt einem armen Jungen anderes übrig, als die Bibel auswendig zu lernen. Das kommt gut an, denn nach dem Sturz Napoleons sind die Zeiten wieder heuchlerisch fromm geworden.
Der Trick verhilft Julien schon einmal zu einer Hauslehrerstelle beim Bürgermeister von Verrières, dem ebenso wohlhabenden wie philiströsen Monsieur de Rênal, dessen gelangweilte Frau er bald verführt. Erfolg haben, Herzen brechen, zu den oberen Gesellschaftskreisen gehören - der Ehrgeiz nagt an Julien Sorel. Im Priesterseminar von Besançon, seiner zweiten Station, macht er sich gerade deshalb verhaßt. Er trifft hier auf lauter entlaufene Bauernsöhne, die sich von der harten Ackerscholle in eine ruhige Pfarrstelle retten wollen, im Wissen, daß es keinen Festschmaus gibt, zu dem die Geistlichkeit nicht geladen wird.
Aber Julien bleibt nicht ohne Protektion. Er wird als Privatsekretär zum Grafen de La Mole vermittelt, gerät in die feinste Gesellschaft von Paris und ist bald selbst "einer der bestangezogenen Männer" der Stadt, ein Dandy, der gleichermaßen mit Eleganz und Intelligenz imponiert. Sein erotischer Widerpart ist nun die Tochter des Grafen, die launenhafte Mathilde de La Mole, ein in jeder Hinsicht bevorzugtes Geschöpf. Ihr Adelsstolz achtet niemanden, der nicht ein paar Vorfahren nennen kann, die an den Kreuzzügen teilgenommen haben. Was einen Mann wirklich auszeichne, meint sie, sei eine Verurteilung zum Tode - denn die sei für Geld nicht zu haben. Sie betreibt einen privaten Ahnenkult mit ihrem Vorfahr Boniface de La Mole, dem im sechzehnten Jahrhundert die Ehre widerfuhr, den Kopf abgeschlagen zu bekommen. Als würde sie bereits ahnen, daß auch Julien am Ende zum Tode verurteilt wird, hat es ihr der "Plebejer" heftig angetan.
Über einige hundert Seiten tobt der grimmige Liebeskampf zweier hochmütiger Seelen. Obwohl es nicht an romantischen Ingredienzen mangelt, sind sich Liebende in einem Roman wohl nie so lieblos ferngeblieben. Statt Gleichklang der Seelen chronische Dissonanz; auf jede unkontrollierte Erhitzung folgen unweigerlich kalte Güsse der Verachtung. Zwei Liebende, die vom Willen zur Macht und zur Unterwerfung des anderen getrieben sind, kennen die Hingabe nur als gefährlichen Kontrollverlust. Wer zugibt, daß er liebt, schwächt seine Position. Also unterdrückt Julien seine Gefühle, um mit taktisch gefriergetrocknetem Herzen die Gebärden der Liebe zu imitieren. Wer erfolgreich lieben will, darf nicht lieben, lautet die Maxime des Verführers, der als Schwiegersohn zu Geld, Adel und Ansehen kommen will.
Die militärischen Formeln und Metaphern ("In die Schlacht!") sind durchaus am Platz. Liebe und Haß werden fast ununterscheidbar. Stendhal stößt "auf die bösartige Motivverschlingung in der Seele eines zurückgedrängten Menschen" (Hugo Friedrich). Während der konventionelle Liebesroman die Leidenschaft in bekömmlichen Portionen serviert, wird dem Leser von "Rot und Schwarz" nicht nur ein Exzeß der Gefühle zugemutet, der in keiner Triebabfuhr zur Ruhe kommt, sondern dazu auch noch die Diffusion der sonst so säuberlich unterschiedenen Emotionen: Rachsucht und Edelmut, giftiges Ressentiment und Seelengröße - alles geht ineinander über. Aber das spricht nicht gegen die Liebe. Anders als Flaubert und Proust gelangt Stendhal nicht zur erotischen Desillusion; vielmehr feiert er den leidenschaftlichen Menschen als ästhetisches Ereignis. Die pure Energie fasziniert.
Und kein Mensch hat so viel Energie freigesetzt wie Napoleon, den der Bewunderer Stendhal nicht als politisches, sondern als vitales Phänomen begreift. "Damals wäre ein Mann wie ich gefallen oder mit sechsunddreißig Jahren General gewesen", meint Julien. Für Stendhal und seine vom "Ennui" geschüttelten Helden ist es eine ausgemachte Tatsache, daß sie im langweiligsten aller Jahrhunderte leben, einer lahmen, prüde moralisierenden, durch und durch nichtigen Zeit. Das Unbehagen an der Moderne hat sie bereits voll erwischt. Auch die Aristokratie bietet keine Zuflucht. Sie pflegt die feine Lebensart im Leerlauf. Die Traumatisierung durch die Revolution und die Angst, ein 1793 könnte sich wiederholen, hat allen Geist aus den Salons vertrieben. Mathilde spottet über ihre Cousinen, "die aus Angst vor dem Volk nicht wagen, mit einem Postillion zu schimpfen, der sie schlecht kutschiert".
Stendhal alias Henri Beyle hatte unter Napoleon in jungen Jahren Karriere gemacht, war in Europa herumgekommen, ein Weltmann, Homme de lettres und Abenteurer. Wie Julien - der viele autobiographische Züge trägt - waren ihm materieller Erfolg und Genuß wichtig. Erst als ihm nach 1815 das gute Leben zu entgleiten begann und er sich deklassiert fühlte, wurde ihm die Gegenwart zum Problem. Sein Realismus ist nicht ganz so objektiv, wie es das berühmte Zitat aus diesem Roman scheinen lassen will: "Ach, Monsieur, ein Roman ist ein Spiegel, der eine Landstraße entlangspaziert. Mal spiegelt er das Blau des Himmels wider, mal den Schlamm der Straße . . ."
In "Rot und Schwarz", rühmte Erich Auerbach, gestalte sich erstmals das moderne Wirklichkeitsbewußtsein. "Chronik aus dem 19. Jahrhundert" lautet der Untertitel; einen Roman unmittelbar in der Gegenwart anzusiedeln irritierte die noch realismusunerprobten Zeitgenossen. Bis in die innersten Antriebe wird der Mensch bei Stendhal äußerlich bestimmt - durch die Gesellschaft, in der er etwas gelten will. Zwar scheint Julien Sorel nur wie zufällig in sein "Milieu" hineingeworfen, aber sein rasender Ehrgeiz ist wiederum nur durch diese Deplazierung zu verstehen.
"Er gab sich eine schier unglaubliche Mühe, alles zu verderben, was liebenswert an ihm war", heißt es an einer Stelle. Von einem zeitgenössischen Kritiker wurde Julien als "widerwärtiger Arrivist" empfunden. "Ich hasse Julien!" schrieb ein anderer; soviel Leidenschaft wird den erschöpften Gestalten unserer Gegenwartsliteratur selten zuteil. Bonapartistische, jakobinische, klassenkämpferische Energie kommen zusammen, um eine Seele permanent unter Hochdruck zu setzen. Am Ende entlädt sich Juliens latente Gewaltbereitschaft in einer kurzen dramatischen Eruption. In einer Kirche schießt er auf Madame de Rênal, die frühere Geliebte, die ihm mit einem denunziatorischen Brief (von einem Priester diktiert!) einen Strich durch die Karriererechnung gemacht hat.
Die Handlung des Romans wurde durch zwei spektakuläre Kriminalprozesse angeregt; in der Charakterisierung löst sich Stendhal jedoch völlig von den Dokumenten und steigert gewöhnliche Verbrecher zum "Ausnahmemenschen" Julien. "Rot und Schwarz" ist ein Triumph der literarischen Psychologie. Mit solcher Eindringlichkeit hatte sich vorher kein Romancier ins Seelenleben gebohrt. Stendhal verschärft die von den Moralisten des siebzehnten Jahrhunderts vorgenommene Analyse der Empfindungen, Eitelkeiten und Leidenschaften - der Schlüsselbegriff ist die Heuchelei, die "hypocrisie".
"Schroffheit, Abgehacktheit, Abruptheit, Härte" - das sind die antiromantischen Züge, die Stendhal seiner Prosa attestierte. Erkenntnisinteresse ist der Begleiter seiner ruppigen Erzählkunst, es beschränkt den Aufwand, der auf schöne Form verwendet wird. Gegenüber dem verbissenen Kunstanspruch Flauberts erscheint Stendhal von lässiger Nachlässigkeit; nichts lag ihm ferner, als tagelang über einem Satz zu brüten. Die Simplizität des Stils hat auch einen schreibtaktischen Vorteil - der Autor kann aufs Tempo drücken. Die "Kartause von Parma", seinen schönsten, souveränsten Roman, sechshundert Seiten stark, diktierte er in sieben Wochen.
Der einundachtzigjährige Goethe las "Rot und Schwarz" gleich nach Erscheinen 1830 und rühmte den "psychologischen Tiefblick", angesichts dessen man "dem Autor einige Unwahrscheinlichkeiten des Details gerne verzeihen mag". Aber erst als Nietzsche fünf Jahrzehnte später die Werbetrommel rührte, kam Stendhal in Deutschland an: "Stendhal, einer der schönsten Zufälle meines Lebens", jubelte er. "Das ist ein Mensch nach meinem Geschmack . . ." Er fand hier viele eigene Themen wieder - die Liebe zu großen, starken Seelen, den antiklerikalen Furor, die Entlarvungspsychologie, den Haß auf das neunzehnte Jahrhundert mit seinem Plüsch und Pomp.
Seitdem erschienen acht Übersetzungen des Romans; die letzte stammt aus dem Jahr 1949. Sie alle haben deutliche Schwächen. Arthur Schurig (1913) griff in den Text nach Belieben ein; stellte um, strich weg. Walter Widmer (1945) schmückte Stendhals karge Sprache aus; knappe Formulierungen werden auf doppelte und dreifache Länge gebracht. Von glanzloser Solidität ist die Arbeit von Rudolf Lewy (1921) - um die drei verbreitetsten Übersetzungen zu nennen. Alle muten sie inzwischen oft älter an als das Original. Ein krasses Beispiel: Die englische Widmung "To the happy few" wird bei Schurig zu "Dem Fähnlein Erkorener".
Die konventionelle deutsche Romansprache der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wird Stendhals Doppelgesicht von Modernität und Romantik nicht gerecht. Glattgestrichen wurde die innere Zerrissenheit und Gespanntheit des Stils - "mal schwarz bis zur Trostlosigkeit, mal rot wie Blut", wie Alfred de Musset schrieb. Analytische Nüchternheit wechselt mit Expressivität, der Realismus der Beschreibungen mit dem Überschwang der Dialoge. Die sorgfältige Neuübersetzung von Elisabeth Edl bringt den Farbkontrast endlich auch im Deutschen zur Geltung. Erstmals ist die Lakonie der Sprache von "Rot und Schwarz" zu genießen, ohne daß eine anachronistische Modernisierung der Preis dafür wäre. "Für das Vokabular wurde überall der Sprachstand von Stendhals deutschsprachigen Zeitgenossen zugrunde gelegt", schreibt Edl im Nachwort, das wie die Anmerkungen ein Höchstmaß an konziser Information bietet. Historisch korrekt und zugleich so frisch wie nie zuvor - ein übersetzerischer Balanceakt, der eindrucksvoll geglückt ist.
Stendhal: "Rot und Schwarz". Chronik aus dem 19. Jahrhundert. Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl. Hanser Verlag, München 2004. 870 S., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Der Gegensatz zwischen Stendhal und Henry Miller ist nur ein Scheingegensatz. Sie gehören zusammen.« Alfred Andersch