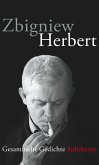Zbigniew Herberts stille Dichtkunst scheut das Pathos nicht / Von Dirk Schümer
Sechsundzwanzig Gedichte. Ein schmales Bändchen, das schon an Gewicht und mit seiner unspektakulären Aufmachung kaum anzukommen scheint gegen die dickleibigen Folianten des Bücherherbstes, in denen die Probleme der Geschichte, der Nation und der Einheit aus allen Blickwinkeln beäugt und tiefsinnig abgehandelt werden. Aber das ist ein weites Feld. Zbigniew Herbert beackert das seine zögerlich, leise und mit der angemessenen Skepsis, ob seine Lyrik in dieser prosaischen Zeit überhaupt noch irgend jemanden erreicht.
Und so redet Zbigniew Herbert - um mit dem titelgebenden Gedicht anzufangen - von Rovigo, einer kleinen italienischen Stadt zwischen Ferrara und Padua. Kennt Herbert Rovigo? "Nie hat mein Fuß diesen Ort berührt", bekennt er offen. Was ist über Rovigo zu sagen? Nicht eben viel: "Rovigo zeichnet sich durch nichts Besonderes aus." Der Dichter erwähnt die unschönen Häuser, die geraden Straßen, den Bahnhof, durch den er stets nur durchgefahren ist. Warum schreibt Herbert dann überhaupt von Rovigo, diesem "Meisterwerk der Durchschnittlichkeit"? Wohl eben gerade, weil es durchschnittlich ist, weil es sich unter den so eigenartigen italienischen Städten durch nichts Besonderes auszeichnet. "Und doch", heißt es, "war es eine Stadt aus Blut und Stein - ganz wie die andern / eine Stadt in der gestern jemand gestorben jemand verrückt geworden / jemand die ganze Nacht über hoffnungslos gehustet hat."
Vielleicht ist das Gedicht in einer Öffentlichkeit, die nurmehr nach dem Spektakulären, dem Besonderen giert, das angemessene Medium, vom Alltäglichen und Privaten zu sprechen - und das Alltägliche ist eben meist unspektakulär. Wie wäre es sonst auszuhalten? So heterogen die sechsundzwanzig Gedichte auch sind - der Zug nach dem Unspektakulären, Alltäglichen zeichnet alle aus, wenn nicht vom Inhalt, dann von der Form her.
Wie sonst nur Hans Magnus Enzensberger hat Zbigniew Herbert jeden hohen Ton aus seiner Lyrik verbannt. Er pflegt über die Trennung von Versen und Strophen hinweg den beiläufigen Tonfall eines bedächtigen, kultivierten Gesprächs. Herbert erreicht diese gelassene Lakonik auch durch den weitgehenden Verzicht auf Interpunktion. Es kommt fast nie zu Umstellungen der kolloquialen Wortfolge. Man kann dieses prosaische Gleiten der Sprache beinahe überall verfolgen: "Also bist Du in Freiburg auch ich war einst dort / um leicht zu verdienen für Papier und für Brot / Unterm zynischen Herzen trug ich naiv die Illusion / ich sei ein Apostel auf Dienstfahrt", schreibt er dem Freund Adam Zagajewski.
Die Verse, deren genau auskalkuliertes Maß nur noch ganz leicht durchscheint, sind hier beinahe aufgehoben vom trockenen, selbstironischen Tonfall des Briefes. Solcherart fiktiven Genre-Wechsel nutzt Herbert meisterlich. Warum heute noch die Mühe eines Gedichtes auf sich nehmen? Eine Ansichtskarte tut es doch auch, oder ein kleiner Prosatext, eine Nachricht oder ein formeller Lebenslauf. Aber gerade diese Stilübungen entpuppen sich als die besten Gedichte.
Herberts falsche Bescheidenheit hat nichts mit manieristischen Spiegelfechtereien zu tun. Kleine formale Täuschungsmanöver gehören zu seiner poetischen Strategie; sie geben seiner Lyrik eine gewisse Umständlichkeit, wie sie auch die feinen Umgangsformen des bürgerlichen Polen auszeichnet, der eine Dame noch mit Handkuß begrüßt. Wenn wir auch keine feinen Damen und Herren mehr sind, bedeutet diese Sitte, so leben wir wenigstens mit der Fiktion etwas angenehmer. Dasselbe gilt für die Gedichte: Wenn sie den zielstrebigeren Formen des Sprechens den Vortritt lassen, bewahren sie wenigstens ihre Würde.
Indem er die großen Themen von Politik und Ethik lässig abtut, holt Herbert sie aus dem Dunstkreis der Feiertagsreden und Leitartikel zurück auf den Boden des kultivierten Gesprächs, wohin sie gehören. "Mitteleuropa" ist so ein Thema. Mit gelindem Überdruß handelt Herbert da einen "gewissen Otto von Habsburg" ab. "Es gab da noch die Bourbonen / doch ehrlich gesagt / sie lohnen sich nicht so ganz." Was am Ende von Mitteleuropa bleibt, ist eine schöne Illusion, derer sich der Dichter fast ein wenig schämt: der Mond mit seiner Magie, seinen uralten Mythen und der versöhnlichen Sicherheit seiner Anwesenheit. "Ein bißchen mag er noch leuchten / das farbige Spielzeug der Kinder / der nostalgische Traum der Alten".
Und im milden Licht des Mondes wird Mitteleuropa, das soeben in Bosnien zu Grabe getragen wird, zu einem Phantom - nett, aber völlig bedeutungslos: "Ich glaub' an das alles nicht recht / (und sag's nur heimlich ins Ohr)". Die Lebenshaltung, von der diese Dramaturgie der verblaßten Mythen und der alltäglichen Mühen spricht, läuft bei Herbert allerdings nicht in jeder Lage auf Koketterie mit der Resignation und der Selbstreferenz hinaus - wie zuweilen bei seinem beinahe ebenbürtigen Kollegen Enzensberger.
Herbert scheut, wenn es angebracht ist, das Pathos nicht. Doch gerade weil es von Plaudereien über das Unspektakuläre umgeben ist, wirkt ein solches Gedicht um so nachhaltiger. Hier spricht Herbert entschieden von den Werten, die ihm etwas bedeuten, und vor allem von den Taten, die einzig zählen. Das Gedicht "Wölfe" überrascht, weil es auf Endreime zurückgreift, weil über fünf Strophen mit je vier Versen ein strenges Maß waltet. Von den "Wölfen" "im guten Schnee ist gelber Harn / und diese Fährte nur geblieben". Und es hätte nicht des Hinweises am Seitenrand bedurft, um zu begreifen, daß hier von den Untergrundkämpfern gegen die Nationalsozialisten die Rede ist.
Daß Herbert - wie in seinem gesamten, immer milder und resignativer werdenden OEuvre - niemals ein Tabu vor dem Feierlichen errichtet hat, hängt mit seiner Nationalität zusammen, die man dem weltläufigen europäischen Plauderer sonst nicht anmerkt. Doch Herbert kommt aus einer Kultur, in der der Dichter noch nicht wie bei uns vom Dichter-Darsteller ersetzt wurde, in der man, zwar selten, noch Menschen stundenlang über Lyrik diskutieren hören kann, in der die Dichter immer noch ein entscheidendes Wort zu sprechen vermögen.
Der Dichter, der den schönen Frauen seines Lebens einen wehmütigen Gruß entbietet ("Der Schwur"), der sich schneidend mit der katholischen Kirche anlegt ("Homilie") oder sein Außenseitertum stilisiert ("Wolken über Ferrara"), konnte diese Gedichte nur als Pole schreiben. Über den vorzüglichen Übertragungen von Klaus Staemmler kann sich der deutsche Leser fragen, ob vielleicht auch bei uns die Verdrängung der Grundbedürfnisse durch die Großsprecherei des Geldes irgendwann einmal ein Ende hat und ob es dann möglich sein wird, wie Zbigniew Herbert vom Heldentum und von der Liebe, von den Ahnen und vom Glauben wieder anders zu schreiben als mit Anführungszeichen.
Der Dichter selbst sieht eher die umgekehrte Entwicklung, aber er fürchtet sie nicht. Auch er, dessen Bücher noch vor gut zehn Jahren daheim verboten wurden, richtet sich nun auf das Exil des Überhörtwerdens ein. Man mußte kein Seher sein, um vorherzusagen, daß das Ende der Unterdrückung des Wortes auch aus der Lyrik Ostmitteleuropas ein Minderheitenprogramm machen würde.
Und doch - ein Lyriker vom hohen Rang eines Zbigniew Herbert hat sowieso nie geschrieben, um bei einem großen Publikum Wirkung zu erzielen: "Der Handvoll die uns zuhört gebührt das Schöne / aber auch die Wahrheit / das heißt - das Grauen / damit sie tapfer sind / wenn der Augenblick kommt".
"Rovigo" ist ein schmales Bändchen. Es zeichnet sich durch nichts Besonderes aus. Es ist ein Meisterwerk der Durchschnittlichkeit. Und doch enthält es sehr viel. Sechsundzwanzig Gedichte.
Zbigniew Herbert: "Rovigo". Gedichte. Aus dem Polnischen übersetzt von Klaus Staemmler. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995. 61 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main