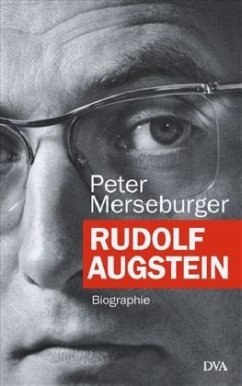Rudolf Augstein war der einflußreichste Journalist der Nachkriegszeit. Peter Merseburger legt nach jahrelangen intensiven Recherchen und Quellenstudien ein Lebensbild des SPIEGEL-Gründers vor, das den bedeutenden Publizisten in all seinen faszinierenden Widersprüchen zeigt.
Rudolf Augstein hat mit der Gründung des SPIEGEL im Jahr 1947 - da war er gerade 23 Jahre alt - nicht nur das erfolgreichste politische Magazin der Bundesrepublik geschaffen, er hat auch den politischen Diskurs des Landes über Jahrzehnte mitbestimmt. Die Geschichte des »Sturmgeschützes der Demokratie«, wie Augstein den SPIEGEL einmal ironisch nannte, ist auch eine Geschichte der Bundesrepublik. Von vielen bewundert, von nicht wenigen gefürchtet, war Augstein eine faszinierende Persönlichkeit, unabhängig und kritisch, mit Witz und scharfem Verstand begabt. Politiker aller Parteien stießen sich ein ums andere Mal an seinem »Schmutzblatt«. Bei aller prinzipiellen Liberalität schwang jedoch immer ein konservativer Grundton mit, und wie Willy Brandt forderte er die deutsche Einheit, als andere sie längst aufgegeben hatten.
Rudolf Augstein hat mit der Gründung des SPIEGEL im Jahr 1947 - da war er gerade 23 Jahre alt - nicht nur das erfolgreichste politische Magazin der Bundesrepublik geschaffen, er hat auch den politischen Diskurs des Landes über Jahrzehnte mitbestimmt. Die Geschichte des »Sturmgeschützes der Demokratie«, wie Augstein den SPIEGEL einmal ironisch nannte, ist auch eine Geschichte der Bundesrepublik. Von vielen bewundert, von nicht wenigen gefürchtet, war Augstein eine faszinierende Persönlichkeit, unabhängig und kritisch, mit Witz und scharfem Verstand begabt. Politiker aller Parteien stießen sich ein ums andere Mal an seinem »Schmutzblatt«. Bei aller prinzipiellen Liberalität schwang jedoch immer ein konservativer Grundton mit, und wie Willy Brandt forderte er die deutsche Einheit, als andere sie längst aufgegeben hatten.

"Mr. Spiegel" und sein Sturmgeschütz: Das Leben Rudolf Augsteins, so wie es sein Kollege Peter Merseburger kennengelernt hatte / Von Michael Hanfeld
Montag war "D-Day" der Bonner Republik: Mit Skandalrecherchen und Rudolf Augsteins Kommentaren und Essays las der "Spiegel" den Mächtigen dieses Landes die Leviten.
Was der "Spiegel"-Gründer Rudolf Augstein bewegt hat, welch ungeheure Rolle er für die Nachkriegsgeschichte Deutschlands spielte, weit über die eines Publizisten hinaus, das weiß man. Der Kanonier hat mit seinem "Sturmgeschütz der Demokratie" fünfzig Jahre lang die Schlachtreihen der deutschen Politik besetzt und gelichtet. Er hat Konrad Adenauers Entscheid für die Westbindung als Irrweg in die ewige Teilung des Landes gebrandmarkt und bekämpft. Franz Josef Strauß als Bundeskanzler hat Augstein verhindert; die sozial-liberale Koalition hingegen hat er im Bewusstsein einer historischen Mission beschworen und die Ostpolitik Willy Brandts unterstützt. Rudolf Augstein war stets Partei, nur nicht immer auf ein und derselben Seite. "Ein Nationaler und ein Liberaler und als solcher sich treu geblieben", sagt Peter Merseburger.
Rudolf Augstein war der "Spiegel", und der "Spiegel" war eine Macht. Solange er als Chefredakteur und Herausgeber fungierte, war der Montag nicht einfach "Spiegel-Tag", sondern der wöchentlich wiederkehrende "D-Day" der Bonner Republik. Bewegt durch Skandalrecherchen und durch Augsteins Kommentare und Essays, in denen er den politisch Handelnden die Leviten las. Ein Monolith, scheinbar. Und doch haderte der Meister mit seinem Instrument, war unsicher in seinen Entscheidungen, wankelmütig in seiner Kommentierung und fühlte sich am Ende wohl eher dem Scheitern näher denn dem Triumph. Er war getrieben von der "Lust zur Selbstzerstörung". Wer war Rudolf Augstein? Und was wollte er?
Peter Merseburger, der von 1960 bis 1965 Redakteur des "Spiegel" war, bevor er zum Norddeutschen Rundfunk ging und in der ARD Chefredakteur und Amerika-Korrespondent wurde, gibt in seiner Biographie zunächst eine Antwort, die wir zu kennen glauben: Augstein sei "ein gnadenloser Realist" gewesen, ein "melancholischer" und "positiver Zyniker", ausstaffiert mit einer "Grundeinstellung, die im Lebensgefühl jener Frontgeneration wurzelt, der er angehörte - die sich missbraucht und verheizt fühlte und, die dröhnenden Propagandalügen des NS-Systems noch im Ohr, nach dem Krieg nicht nur ,Dies nie wieder!' schwor, sondern seither jedem Wort misstraute." So sei der "Spiegel" zu einem "Institut der Respektlosigkeit" geworden, zu einer "Volkshochschule der Ehrfurchtsverweigerung und Skepsis gegenüber aller Autorität, zu einem Blatt des Infragestellens", ohne die ein demokratischer Diskurs nicht zu denken sei.
Zu denken ist dieser Diskurs im Nachkriegsdeutschland vielleicht in der Tat nicht ohne Augstein und ohne den "Spiegel". Wobei dem späten Leser sich die Frage aufdrängt, ob Augstein und seine Leute wirklich "jedem" Wort misstrauten oder nicht doch "jedem" außer dem eigenen - das ex cathedra, im Brustton moralischer Überlegenheit und mit der Lust an der rhetorischen Vernichtung formuliert wurde. Seite um Seite liest man bei Merseburger nun den brachial geführten Kulturkampf des "Spiegel" in den fünfziger und sechziger Jahren nach, der 1962 in der "Spiegel"-Affäre mündete, in deren Folge Augstein wochenlang in Haft saß, am Ende aber triumphierte und Franz Josef Strauß seine bundespolitische Karriere fürs Erste begraben musste.
Und man wundert sich, wie akribisch der Biograph die Irrungen und Wirrungen der politischen Standpunkte Augsteins benennt - die ihn oft nicht als Realisten, sondern als Situationisten, wenn nicht Opportunisten erscheinen lassen. Man wundert sich, wie detailliert Merseburger den Aufbau der Redaktion auch mit Autoren schildert, die ihr Handwerk im NS-Reich gelernt hatten, um am Ende doch stets zu dem Ergebnis zu kommen, dass Augstein nicht anders handeln konnte oder musste, als er es tat. Das wirkt - und an einigen Stellen spricht der Biograph, der Augstein gegen jeden Antisemitismus-Verdacht verteidigt und vorsichtig seine Haltung zu Frankreich erörtert, es explizit aus -, als wolle er Augstein nachträglich vor dem Urteil jüngerer Autoren bewahren, etwa dem eines "Achtundsechzigers" wie Lutz Hachmeister. In diesem Habitus ähnelt Merseburger dem, den er schildert, wenn Augstein von der NS-Herrschaft oder vom Krieg schrieb oder gegen das Engagement deutscher Soldaten auf dem Balkan oder im Nahen Osten wetterte: Die Nachgeborenen, sie verstehen einfach nicht. In weiten Teilen liest sich Merseburgers Augstein-Biographie wie eine verständnisvolle Einführung in die deutsche Nachkriegsmentalitätsgeschichte. Die große Sympathie, die der Autor für "Mr. Spiegel" empfindet, ist unverkennbar, doch verstellt sie Merseburger glücklicherweise nicht ganz den Blick.
Die besten Kapitel der glänzend geschriebenen Biographie handeln von dem jungen und von dem durch seine Alkoholkrankheit gezeichneten alten Augstein. Hier macht sich bemerkbar, dass Merseburger Zugang zu persönlichen Aufzeichnungen Augsteins hatte und sich intensiv in seinem engen persönlichen und beruflichen Kreis umgehört hat. So lernen wir Augstein endlich einmal als den am 5. November 1923 in Hannover geborenen, oft kränklichen Spross einer neunköpfigen katholischen Familie kennen, die es in die Hannoveraner Diaspora verschlagen hat - womit sich für Augstein das Gefühl einer gewissen Heimatlosigkeit verbindet. In der Schule ist er ehrgeizig, in seine Aufsätze schmuggelt er Widerworte gegen die im Unterricht durchgepaukte NS-Ideologie. Er will Journalist werden, volontiert im Feuilleton des "Hannoverschen Anzeigers". Doch dann kommen der Arbeitsdienst und die Einberufung zur Wehrmacht. Noch als Soldat an der Ostfront schreibt Augstein kleine Feuilletons.
Nach dem Krieg, mit Anfang zwanzig, gerät Augstein in Hannover an die richtigen, an die unorthodoxen britischen Presseoffiziere John Seymour Chaloner, Henry Ormond und Harry Bohrer, die ihn und Andere kritische Artikel schreiben und schließlich ein Magazin entwickeln lassen, das seiner Zeit in Deutschland weit voraus ist: ein "Lasso-Satz" zu Beginn, der die Leser einfängt, und dann eine spannende Reportage oder Recherche. Wie sich daraus der berüchtigte "Spiegel"-Jargon entwickelte, das beschreibt Merseburger als Prozess kollektiver Selbstfindung: Man meine beim Durchblättern der alten Hefte "förmlich zu spüren, wie sich die Redaktion vorsichtig von Position zu Position tastet", schreibt er. Die Bezeichnungen allerdings, die sich in diesen Heften der Bundeskanzler Adenauer einfing, bezeugen das "vorsichtige Tasten" ganz und gar nicht und auch nicht die großangelegten Serien, mit denen der "Spiegel" aufwartete, eine davon stammte aus der Feder des ehemaligen NS-Wirtschaftsministers Hjalmar Schacht.
Interessant ist, dass Merseburger Augstein in der "Spiegel"-Krise nicht als Helden, sondern als jemanden ausweist, der sich zunächst einmal wegducken wollte, der angibt, die fragliche Titelgeschichte, die dem "Spiegel" die Ermittlungen wegen angeblichen Geheimnisverrats eintrug, überhaupt nicht gesehen zu haben. In der Haft aber zeigt sich Augstein unbeugsam und siegt am Ende, weil sich eine Solidarisierung in der Öffentlichkeit und in der Presse einstellte, wie wir sie seither nicht mehr gesehen haben. In den sechziger und siebziger Jahren läuft das Geschäft, und Augstein langweilt sich. Es gilt neue Flure zu finden, und dabei ist Augstein als Verleger viel weniger erfolgreich denn als Journalist.
Die geplante Überkreuzfusion mit Gerd Bucerius und der "Zeit" misslingt ebenso wie die Entwicklung einer eigenen Zeitung. Im "Spiegel" behält Augstein zwar das Sagen, überantwortet seinen Mitarbeitern aber schon 1971 die Hälfte des Kapitals und entmachtet seine Kinder, die nach seinem Tod von seinen fünfundzwanzig Prozent Kapitalanteilen jeweils ein halbes Prozent an die Mitarbeiter KG und an den dritten Teilhaber Gruner + Jahr abgeben müssen. Das ist ein Punkt, der Augsteins Kinder quält, vor allem seine Tochter Franziska. Denn der Weg zur Macht im "Spiegel" scheint ihnen - zumindest direkt - verbaut. Hochumstritten ist deshalb die Frage, ob Rudolf Augstein es ernst meinte, als er den Bertelsmann-Patriarchen Reinhard Mohn - als obersten Boss seines Teilhabers Gruner + Jahr - bat, die Verfügung mit den zwei halben Prozenten zurückzunehmen. Erwartete der "gnadenlose Realist" Augstein tatsächlich, dass Mohn sich bereitfände, genau den Anteil, der im "Spiegel" über Macht und Ohnmacht entscheidet, freiwillig zurückzugeben? Oder wollte Augstein nur seinen Kindern einen Gefallen und so tun, als ob er sich engagiere? Oder gab er nur ihrem Drängen nach? Obwohl sich das nicht eindeutig klären lässt, gibt Merseburger der Interpretation den Vorzug, dass Augstein tatsächlich etwas für seine Kinder tun wollte. Doch für eine dynastische Lösung war es zu spät.
Mit bewundernswerter Eleganz umschreibt Merseburger das wechselvolle Privatleben Augsteins, seine außerehelichen Amouren und seine Ehen, die so schnell Risse bekamen, wie sie geschlossen worden waren. Weil Merseburger die Perspektive durchs Schlüsselloch fremd ist, vermag er die pikanten Geschichten umso lapidar-schöner zu erzählen, was ihn immer wieder auch auf die entscheidenden Punkte von Augsteins Vita führt, wie die Frage, ob nicht die grundstürzende Idee, den "Spiegel" quasi hälftig zu vergesellschaften, auf Augsteins Freundin und dann Frau Gisela Stelly zurückgeht.
Peter Merseburger bleibt in seiner Biographie fast immer auf Halbdistanz zu seinem Gegenstand. Nur eines scheint ihm erstaunlicherweise zu fehlen: Ein Gespür für die Hybris, die sich mit der Geschichte und mit den Ansprüchen eines Rudolf Augstein genauso verbindet wie mit denen eines Axel Cäsar Springer oder eines Henri Nannen: Bundeskanzler kamen und gingen, sie schrieben, druckten oder verlegten für Deutschland oder vielleicht sogar für die halbe Welt.
Am Ende, das sieht Merseburger, und das hat wohl auch Augstein gesehen, ficht der "gnadenlose Realist" auf verlorenem Posten - er hat von seinem Reich abgegeben, heute tummeln sich dort andere. Doch kann man darin auch ein Element von Augsteins Größe erkennen. Einen erfolgreicheren Journalisten hat es in diesem Land nicht gegeben. Außer ihm selbst, dem "Verehrungsverweigerungsgenie", dürften das viele so sehen, so auch Merseburger.
Peter Merseburger: "Rudolf Augstein". Biographie. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007. 560 S., Abb., geb., 23,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eine durchweg gelungene Biografie Rudolf Augsteins ist das, konstatiert Michael Hanfeld, "glänzend geschrieben", mit besonderen Stärken im Porträt des jungen und dann des alten Augstein. Merseburger, der von 1960 bis 1965 selbst Spiegel-Redakteur war und seine grundsätzliche "Sympathie" für seinen Gegenstand nicht verbirgt, bleibe die allermeiste Zeit "auf Halbdistanz". Dies erst ermögliche ihm, das Porträt des Spiegel-Gründers im weiten und genau getroffenen Kontext einer "deutschen Nachkriegsmentalitätsgeschichte" zu situieren. Auch dass er Zugang zu unpublizierten Aufzeichnungen Augsteins hatte, komme der Biografie zugute. Merseburgers Einschätzung, dass sich Augstein bei allen Erfolgen doch auch als immer wieder Scheiternden und zuletzt vielleicht sogar als Gescheiterten sah, hält Hanfeld zudem für zutreffend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH