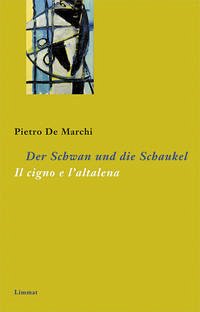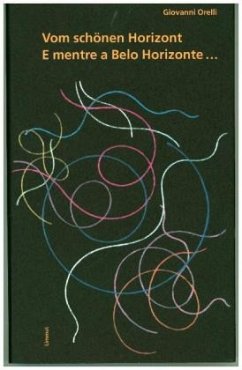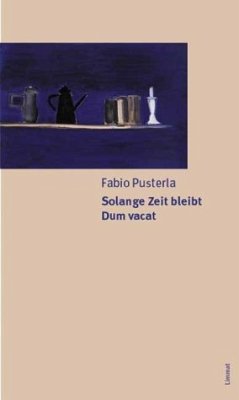Rückspiel /Partita di Ritorno
Gedichte
Herausgegeben: Ferber, Christoph;Übersetzung: Ferber, Christoph
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Rückspiel /Partita di Ritorno
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.