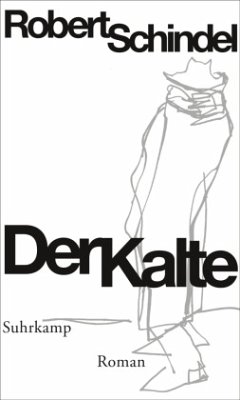Nicht lieferbar

Ruhige Zeiten
Roman
Übersetzung: Pressler, Mirjam
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Leale, die Maniküre, arbeitet seit über dreißig Jahren im kleinen Friseursalon von Sajtschik. Nach dessen Tod bricht ihre Welt auseinander, nicht das erste Mal. "Der Krieg hat uns die Familie und die Verwandten genommen, und die Zeit, die vergeht, nimmt uns die Nachbarn und die Freunde." Die Tage der Trauer lassen Erinnerungen in ihr aufsteigen - Erinnerungen an die Menschen, die ihr Leben waren und sind: den geliebten Sajtschik, seinen von ihr weniger geliebten Freund Mordechai, der Leale nach demKrieg aus Polen nach Israel brachte, den einzigen Sohn Etan und viele andere. So tritt die Wel...
Leale, die Maniküre, arbeitet seit über dreißig Jahren im kleinen Friseursalon von Sajtschik. Nach dessen Tod bricht ihre Welt auseinander, nicht das erste Mal. "Der Krieg hat uns die Familie und die Verwandten genommen, und die Zeit, die vergeht, nimmt uns die Nachbarn und die Freunde." Die Tage der Trauer lassen Erinnerungen in ihr aufsteigen - Erinnerungen an die Menschen, die ihr Leben waren und sind: den geliebten Sajtschik, seinen von ihr weniger geliebten Freund Mordechai, der Leale nach demKrieg aus Polen nach Israel brachte, den einzigen Sohn Etan und viele andere. So tritt die Welt ihres Tel Aviver Viertels lebensvoll vor Augen, in dem sich nach dem Krieg Menschen von "dort", Überlebende der Shoah, wiederfanden, ein neues Leben begannen, soweit das eben möglich war.
Lizzie Doron erzählt mit erhellendem Witz und großer menschlicher Wärme vom fragilen Balanceakt des "Dennoch", der die Geschichten all dieser Menschen prägt. Sajtschiks Friseursalon ist der Ort, an dem all je
Lizzie Doron erzählt mit erhellendem Witz und großer menschlicher Wärme vom fragilen Balanceakt des "Dennoch", der die Geschichten all dieser Menschen prägt. Sajtschiks Friseursalon ist der Ort, an dem all je