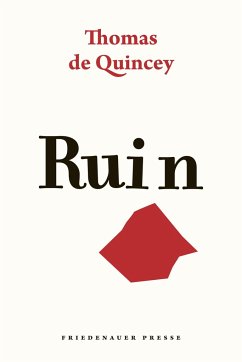Als Agnes, die junge Frau des Erzählers, an einem strahlenden Frühlingstag aufbricht, um in der Stadt kleinere Besorgungen zu erledigen, ahnt noch niemand von dem Unwetter, das sich bereits über ihr zusammenbraut. Selbst das diffuse Gefühl ihres Mannes, dass sich von irgendeiner geheimen Stunde an immerzu ein Unheil auf ihn und seine Familie zubewege, rüstet keinen der beiden hinlänglich dafür, dass schon bald alle Marksteine eines erinnerungswürdigen Glücks hinweggefegt und von dem Frieden und dem Ansehen ihres bisherigen Lebens nur mehr Ruinen bleiben werden. Geschrieben in einer Zeit, als finanzielle Schwierigkeiten Thomas de Quincey und seine Familie zwangen, wiederholt Zuflucht in Edinburgh zu suchen, erzählt der Roman von den kulturellen wie gesellschaftlichen Kräften, die sich teilnahmslos und unerbittlich entwickeln, »unbekümmert darob, wen oder wie viele sie vernichten«. Es ist die Erzählung einer falschen Anschuldigung, basierend auf dem Fall der Mrs. Jane Leigh Perrot, einer Tante Jane Austens, die Anfang 1800 wegen Ladendiebstahls angeklagt worden war; einer Anschuldigung, die hier, anders als im wahren Streitfall, den individuellen Schuldspruch wie den verheerenden Untergang einer ganzen Familie nach sich zieht.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Offensichtlich graben deutsche Verlage gerade in den Bücherkisten des 19. Jahrhunderts: "Ruin" ist der Titel für die deutsche Übersetzung eines 1838 erschienenen Romans von Thomas De Quincey. Nach sieben schmalen, aber schwer verdaulichen Seiten fühlt sich Rezensent Tilman Spreckelsen durch den britischen Schriftsteller allerdings reich beschenkt: Denn die Geschichte eines alten Mannes, der über seine Ehefrau Agnes erzählt, findet er ungeahnt mitreißend. Weil De Quincey verstand, die Leser zu narren, ob der ständig um den eigenen Bauchnabel kreisende Mann die tragische Wahrheit über seine Ehe erzählt oder sich selbstgerecht gegen jede Kritik wappnet - ohne zu bemerken, dass er seine Frau über weite Strecken ihres Lebens vergessen hatte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Thomas De Quincey kittet seine Welt
Dass "jede Schwäche Leid und Erniedrigung" mit sich bringt, dass schlimme Schicksalsschläge immerhin den Unbeteiligten als Lehre dienen können und daher auch ihr Gutes haben, dass schließlich angesichts der unerbittlichen Zeit jedes Glück nur geborgt ist und endlich - wer mag das noch lesen, wer hält derlei sieben Seiten lang aus, der nicht eine Schwäche für moralische Traktate hat?
Thomas De Quinceys Text "Ruin", im Original unter dem Titel "The Household Wreck" 1838 in "Blackwood's Edinburgh Magazine" publiziert, setzt so ein, aber wer besagte sieben Seiten übersteht, wird nicht nur reich belohnt, er versteht am Ende auch, warum diese Hürde am Anfang stehen musste. Denn der Erzähler von "Ruin", ein alter Mann, der ein halbes Jahrhundert zurückblickt auf jene Zeit, als er in seinen Zwanzigern war, braucht diesen Anlauf über das Allgemeine, über Schicksal und Untergang an sich, um dann auf seine eigene Geschichte zu kommen. Er stellt, was ihm selbst widerfahren ist, in einen sinnstiftenden Rahmen, und der gewitzte Autor lässt ihn gewähren - schließlich sendet der Erzähler so ungewollt ein erstes, überdeutliches Signal an die Leser, in der Wiedergabe der nun folgenden Geschichte immer auch die deutende Hand dessen zu sehen, der sie erlitten hat.
Erlitten? Das eigentliche Opfer ist Agnes, die junge Frau des zu Beginn der Handlung ebenfalls noch jungen Erzählers, der von sich sagt: "Ich war jung, ich war stark, ich war, in einem sehr diesseitigen Sinne, erfolgreich! Keinem schuldete ich einen Heller, keinen musste ich meiden, niemand aus dem Weg gehen." Seiner Ansicht nach wurde er damals nicht etwa wegen seines ererbten Reichtums, sondern wegen seiner "persönlichen Qualitäten" geschätzt, und der Ahnung, dass sich hier eine moderne Hiob-Geschichte anbahnt, wird man an dieser Stelle kaum entgehen.
Tatsächlich geht Agnes, die junge Mutter eines kleinen Sohnes, an einem schönen Frühlingstag aus und kommt nicht zurück. Der aufgeregte Ehemann erfährt nach Stunden der Angst, dass sie festgenommen wurde, weil sie in einem Stoffgeschäft etwas gestohlen haben soll. Natürlich kann das nur eine Intrige sein, glaubt ihr Mann damals ebenso wie fünfzig Jahre später, und die Schuldigen sind bald ausgemacht: eine junge Hausangestellte, die bald eine neue Stelle sucht und, wie der Erzähler mit einiger Befriedigung vermerkt, elend zugrunde geht, sowie der Ladenbesitzer, der Agnes fälschlich bezichtigte, damit sie ihm sexuell zu Willen sei.
All dies lässt Thomas De Quincey (1785 bis 1859), der Autor der ungleich berühmteren "Bekenntnisse eines englischen Opiumessers", seinen Erzähler mit viel Raum für gegenläufige Interpretationen der ausgebreiteten Handlung berichten. Dabei geht es nicht notwendig um die tatsächlichen Geschehnisse, um die Frage also nach Schuld oder Unschuld von Agnes oder wie das seltsame Verhalten des kleinen Sohnes zu deuten ist, der schwört, er habe seine Mutter eben noch im Schlafzimmer gesehen, als sie eigentlich unterwegs war.
Vielmehr geht es um die Welt, die der Erzähler sich konstruiert, die er abdichtet gegen alles, was nicht hineinpasst und ihr Gefüge sprengen würde, um eine Suada also, die uns und vor allem ihn selbst davon überzeugen soll, dass seine Ehe von nichts getrübt, makellos, geradezu "glückselig", wie er sie nennt, gewesen sei und dass Agnes dann tatsächlich in seinen Armen, abgeschirmt von ihren Nachstellern, vor Erschöpfung gestorben sei - es ist eine grausige Realität hinter diesen Schilderungen denkbar, die der Erzähler, falls es denn so war, auch nach fünfzig Jahren dauerhafter Geschichtskonstruktion nicht spurlos getilgt hätte.
Dass wir diese Frage nicht entscheiden können, ist ein Resultat der Klasse dieses Autors. Und ebenso, dass wir seinem Erzähler nicht trauen. Agnes bleibt dabei völlig auf der Strecke, so wie ihr Mann ihr schon im Gefängnis nicht helfen konnte, als er selbst todkrank zu Hause lag. Wie aber Schwäche - seine Schwäche - Leid und Erniedrigung mit sich bringt, führt der Erzähler ungewollt vor. Und rechtfertigt damit die ersten sieben Seiten des ungeheuren schmalen Bandes. TILMAN SPRECKELSEN
Thomas De Quincey: "Ruin".
Aus dem Englischen von Andreas L. Hofbauer. Friedenauer Presse, Berlin 2022. 194 S., br., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main