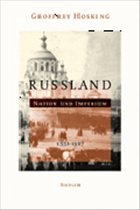Gibt es überhaupt eine russische Geschichte?
Der Autor unterscheidet in seiner Untersuchung zwischen dem russischen Imperium und der russischen Nation. Es gibt zwei Geschichten, und die Frage nach der russischen Geschichte ist die Frage nach ihrem Verhältnis.
Das russische Imperium war gefräßig. Es verleibte sich andere Ethnien ein, bevor die russische Nation eine Identität entwickeln konnte. Mehr noch: was an authentisch russischen Traditionen existiert hatte, wurde durch die imperialistische Reichspolitik unterdrückt.
Im russischen Imperium war es immer die Aufgabe der Stunde, durch einen überbordenden Verwaltungsapparat riesige Territorien und verschiedenartige Völker in den Griff zu kriegen. Setzte sich hingegen jemand für die russische Nation und ihr Gemeinschaftsgefühl ein, wurde er stets mit dem Vorwurf des Chauvinismus bedacht.
Wer hätte das Volk integrieren können? Die russisch-orthodoxe Kirche war zu schwach, ein Bürgertum fehlte und die Intelligenz war entwurzelt. Wo aber kein Wir-Gefühl vorhanden ist, gibt es auch keine gemeinsamen Fortschrittsanstrengungen. Es entstand ein mächtiges russisches Reich ohne russische Seele und eine schwache russische Nation ohne Nationalgefühl.
So lautet denn auch die Diagnose des Autors: Die russische Nationalgeschichte liegt in der Zukunft.
Der Autor unterscheidet in seiner Untersuchung zwischen dem russischen Imperium und der russischen Nation. Es gibt zwei Geschichten, und die Frage nach der russischen Geschichte ist die Frage nach ihrem Verhältnis.
Das russische Imperium war gefräßig. Es verleibte sich andere Ethnien ein, bevor die russische Nation eine Identität entwickeln konnte. Mehr noch: was an authentisch russischen Traditionen existiert hatte, wurde durch die imperialistische Reichspolitik unterdrückt.
Im russischen Imperium war es immer die Aufgabe der Stunde, durch einen überbordenden Verwaltungsapparat riesige Territorien und verschiedenartige Völker in den Griff zu kriegen. Setzte sich hingegen jemand für die russische Nation und ihr Gemeinschaftsgefühl ein, wurde er stets mit dem Vorwurf des Chauvinismus bedacht.
Wer hätte das Volk integrieren können? Die russisch-orthodoxe Kirche war zu schwach, ein Bürgertum fehlte und die Intelligenz war entwurzelt. Wo aber kein Wir-Gefühl vorhanden ist, gibt es auch keine gemeinsamen Fortschrittsanstrengungen. Es entstand ein mächtiges russisches Reich ohne russische Seele und eine schwache russische Nation ohne Nationalgefühl.
So lautet denn auch die Diagnose des Autors: Die russische Nationalgeschichte liegt in der Zukunft.

Die Kinder sollen sich mit den verstorbenen Klassikern beschäftigen: Geoffrey Hosking weiß, was dem Nationalstaat frommt
Es war einmal ein kleiner Soldat. Der hieß Iwan Tschonkin und wurde in die Einöde eines Dorfes geschickt, um dort ein abgestürztes Flugzeug zu bewachen. Mit Ausbruch des Krieges geriet er bei seinen Vorgesetzten jedoch in Vergessenheit - und nun entspinnt sich das, was man fast ein sozialistisches Idyll nennen könnte. Tschonkin lässt sich mit einer Bäuerin ein, gräbt ihr den Garten um, repariert das Dach, wird sesshaft und tritt die Rückverwandlung vom Soldaten in den Bauern an. Viel besser, ein guter Dorfbewohner als ein schlechter Gefreiter zu sein.
In dieser Geschichte des russischen Satirikers Wladimir Wojnowitsch steckt eine Parabel auf Russland, als es noch den sowjetischen Mantel trug: Der Staat zwingt die Bauern, die Scholle zu verlassen, und presst sie in Organisationen, die ihnen fremd bleiben. Noch dazu erschwert er die Anpassung, indem er die Bauern nur mit unzureichenden Mitteln ausstattet, so dass sie an ihrer Aufgabe scheitern müssen. Ganz logisch, dass die Untergebenen den Zwängen ausweichen, ja sich sogar daranmachen, offizielle Strukturen zu inoffiziellen Beziehungen umzukrempeln. Das Ethnografische beginnt das Politische immer wieder zu überwuchern, bis auch die Beamten begreifen: Ihr Kampf ist aussichtslos.
Der in London lehrende Russland-Historiker Geoffrey Hosking legt diese Satire sogar auf die Epoche der Zaren um. Auf den ersten Blick stützt er damit Positionen, die sich von denen vieler seiner deutschen Kollegen wohltuend unterscheiden. Von Dogmen wie Autokratie und Rückständigkeit, auf denen hier zu Lande manch einer immer noch herumkaut, hält Hosking gar nichts. Bravo! Endlich! Beides siedelt Hosking nur auf der Ebene der Symptome an, nicht auf der von Ursachen. In der Tat dringt man weitaus tiefer in die russische Geschichte ein, wenn man Russland nicht als "staatsbedingt" im Sinne überbordender Autokratie auffasst, sondern als "unterregiert". Darauf weisen nicht erst die Erfahrungen der neunziger Jahre hin, als sich Jelzin im Umkreis seines Schreibtischs als nahezu absoluter Herrscher aufspielen konnte - nur dass seine Macht schon an der Haustür zu versickern begann.
Hoskings Zugang ist daher nicht der schlechteste. Die Tür aber auch zu öffnen und "einen neuen Deutungsansatz für die Beschäftigung mit der Geschichte Russlands" zu entwerfen, an dieser Aufgabe scheitert er ebenso gründlich wie Iwan Tschonkin bei der Bewachung des Flugzeugwracks. Was Hosking zum sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert zu sagen hat, ist (im Jargon der Rotarmisten) doch eine recht dünne Suppe. Konzeptionslos mümmelt der Autor alte Binsenweisheiten herunter und weiß durch mancherlei Fehler insbesondere auf dem Felde der Kirchengeschichte auch nicht sonderlich geschickt zu würzen.
Im Grunde merkt man dem Buch daher deutlich an, dass Hoskings Kenntnis der russischen Geschichte erst im neunzehnten Jahrhundert an Tiefe gewinnt. Hier bringt er eine These vor, die seltsam anachronistisch wirkt. Finde das heutige Russland zu einer neuen Identität als Nationalstaat unter anderen Nationalstaaten, seien Autokratie und Rückständigkeit zu überwinden. Einerseits wäre dem entgegenzuhalten, dass wir uns hoffentlich auf eine postnationale Ära zubewegen, die eines Tages auch Russland erfasst. Andererseits ist der Weg zum "Nationalstaat" gerade für Russland - zahlreicher Minderheiten wegen - nicht einfach zu beschreiten. Hosking führt sein Argument aber noch weiter. Das "Solidaritätsgefühl", das mit dem Nationalstaat einhergehe, werde einiges zur Verminderung der Kriminalität wie zur Entschärfung der politischen Konflikte beitragen. Ganz abgesehen davon, dass beide Annahmen auf reiner Spekulation beruhen (um es zurückhaltend auszudrücken), wäre doch die Frage, ob Finnen, Balten, Polen, Ukrainer oder Deutsche die Stärkung der russischen Nationalidentität mit inniger Freude beobachten würden beziehungsweise ob sich hier nicht sogar ein Schritt zu neuerlichen Konflikten vorbereiten könnte.
Nicht absonderlich, sondern nur konventionell wirken insbesondere die kulturgeschichtlichen Passagen, die Hosking seiner Darstellung einmontiert hat. Puschkin, Gogol, Tolstoi, Dostojewski - sie alle kommen knapp zur Sprache. Auch hier schweift der Verfasser jedoch immer wieder zu seiner idée fixe ab, zum Beispiel durch die These, Ende des neunzehnten Jahrhunderts habe sich eine wirkliche russische Nation gebildet, allerdings nur in Form eines Lesepublikums, das selbst die Sowjetzeit überdauert habe und noch heute die Gewähr dafür biete, dass Russland doch in einen Nationalstaat verwandelt werden könne.
Gleichwohl gelingen Hosking mitunter auch lesenswerte Abschnitte, so wenn er ins Einzelne geht. 1903 versammelten sich in einem Kloster bei Tambow mehr als 300 000 Menschen, um zu erleben, wie Nikolaus II. den Sarg des heiligen Serafim in die Kirche überführte. "Menschen füllten die Klosteranlagen, standen in ehrfürchtigem Schweigen, in jeder Hand eine Kerze. Hier befand sich buchstäblich ein Feldlager von Pilgern, Menschenmassen, Wagen und Kutschen jeder Art. Singende Stimmen erklangen von verschiedenen Orten aus, aber die Sänger waren nicht zu sehen, und die Stimmen schienen vom Himmel selbst zu kommen." Hosking nutzt diese Episode, um sowohl den Zaren wie die Kirche einer nüchternen Analyse zu unterziehen. Nikolaus gefiel sich in der Rolle des volksnahen Herrschers, der lieber selbst zu den Bauern aufs Land fuhr, als diese nach Moskau oder Petersburg kommen zu lassen und sie dort "schädlichen" Einflüssen auszusetzen. Den Anlass dazu besorgte er sich notfalls selbst, so durch Bevormundung der Kirche, die Serafim, einen Asketen und Wundertäter des frühen neunzehnten Jahrhunderts, der Heiligsprechung nicht für würdig hielt. Nur wegen dieser heillosen Romantisierung von Gläubigkeit und Volk fielen Nikolaus und seine Gemahlin schließlich auch auf Rasputin herein.
Derartige Abschnitte sorgen schon deshalb für Belebung der Lektüre, weil sich Hosking gemeinhin eher den Strukturen widmet, auch wenn sie nicht immer ganz plastisch werden. Gerade wegen dieses eigentlich verdienstvollen Interesses an anonymen Schubkräften wirkt die Darstellung für die Zeit nach 1905 wie zusammengestoppelt. Der zunehmenden Dynamik aus Struktur und Ereignis wird Hosking immer weniger gerecht. Kaum glaublich, aber wahr: Der Erste Weltkrieg, der doch das Zarenreich verschlang, wird auf ganzen drei Seiten behandelt. Auch das Resümee wird manch einer nur unter Kopfschütteln lesen. Was die russische Gesellschaft im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert zusammenhielt, so Hosking, war die Armee: Sie nahm Leibeigene auf, befreite sie von der Erbuntertänigkeit und formte sie zu Bürgern um, die bewusst für Zar, Glauben und Vaterland kämpften. Kein Bravo, nur noch Buh. So einfach war's nun doch nicht, und "Bürger" mit Veteranen gleichzusetzen ist einfach absurd. Von manchem Fehlgriff und manchem guten Ansatz abgesehen, stellt Hosking alles in allem eine Geschichte Russlands auf die Beine, die so arm ist an neuen Ideen, dass sein Buch ohne Zweifel weite Verbreitung finden wird.
CHRISTOPH SCHMIDT
Geoffrey Hosking: "Russland". Nation und Imperium 1552-1917. Aus dem Englischen von Kurt Baudisch. Siedler Verlag, Berlin 2000. 576 S., 4 Karten, geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Christoph Schmidts anfänglicher Begeisterung für dieses Buch scheint schnell die Ernüchterung gefolgt zu sein. Zwar gefällt ihm, dass Hosking sich von hierzulande verbreiteten "Dogmen wie Autokratie und Rückständigkeit" hinsichtlich der Zarenzeit distanziert. Mit einem wirklich neuen Deutungsansatz jedoch habe der Autor hier unzweifelhaft Schiffbruch erlitten. Zum sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert seien Hosking vor allem "Binsenweisheiten" eingefallen und auch so manche Fehler unterlaufen. Kaum anfreunden kann sich Schmidt darüber hinaus mit Hoskings These, dass eine neue Indentität als Nationalstaat Russland heute helfen könne, "Autokratie und Rückständigkeit zu überwinden". Angesichts der zunehmenden Überwindung nationalstaatlicher Eigeninteressen und der Probleme, die dadurch aufgrund der zahlreichen Minderheiten entstehen, kann sich der Rezensent über solche Überlegungen nur wundern. Zwar findet Schmidt einzelne Passagen des Buches auch gelungen, etwa da, wo Hosking durch die Beschreibung der Überführung des Sargs des heiligen Serafim in eine Kirche gleichzeitig die Haltung Nikolaus II. zu seinen Untertanen deutlich macht. Dass der Erste Weltkrieg in dem Buch aber gerade einmal drei Seiten umfasst, gehört zu den Schwächen des Bandes, die der Rezensent mit "Kopfschütteln" kommentiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH