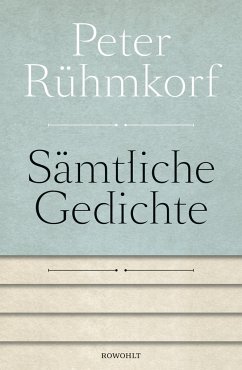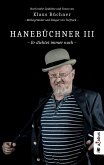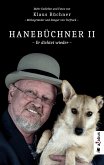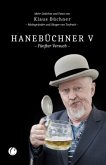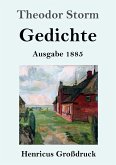Sämtliche Gedichte Peter Rühmkorfs in hochwertiger Ausstattung, herausgegeben von Bernd Rauschenbach - ein Muss für alle Lyrik-Leser!
Bleib erschütterbar und widersteh, Wo die Götter die Daumen drehen, Einen zweiten Weg ums Gehirn rum - bereits die Titel der Gedichte verströmen diesen ganz eigenen Sound, der Peter Rühmkorfs Lyrik so unverwechselbar macht. Hier spricht einer der großen deutschen Dichter, der mit überlieferten Versformen jongliert, freie Rhythmen zum Swingen bringt, Reime bricht und wieder flickt; der vor den großen Themen, "leichthin über Liebe und Tod", nicht zurückschreckt, aber auch dem banalen Alltag Glanzlichter aufsetzen kann: der Reflex eines zitternden Buttermessers morgens auf der Frühstücksbacke.
Rühmkorfs Lieblingsplatz war immer zwischen den Stühlen - selbst wenn sie auf schwankendem Hochseil standen. In diesem Band sind erstmals alle seine Gedichte versammelt, von der 1956 erschienenen Broschüre Heiße Lyrik bis hin zu dem kurz vor seinem Tod zusammengestellten Band Paradiesvogelschiß von 2008.
«Nichts Höheres möchte der Reim, als freudig mit den Ohren gelöffelt und der Seele als ein Lockruf eingeflüstert werden. Und nichts Edleres hat er im Sinn, als den Zusammenklang des tragisch Getrennten, fatal Auseinandergerissenen, umständehalber Zerteilten wenigstens für einige Atemzüge lang als möglich erscheinen zu lassen.» Peter Rühmkorf
Bleib erschütterbar und widersteh, Wo die Götter die Daumen drehen, Einen zweiten Weg ums Gehirn rum - bereits die Titel der Gedichte verströmen diesen ganz eigenen Sound, der Peter Rühmkorfs Lyrik so unverwechselbar macht. Hier spricht einer der großen deutschen Dichter, der mit überlieferten Versformen jongliert, freie Rhythmen zum Swingen bringt, Reime bricht und wieder flickt; der vor den großen Themen, "leichthin über Liebe und Tod", nicht zurückschreckt, aber auch dem banalen Alltag Glanzlichter aufsetzen kann: der Reflex eines zitternden Buttermessers morgens auf der Frühstücksbacke.
Rühmkorfs Lieblingsplatz war immer zwischen den Stühlen - selbst wenn sie auf schwankendem Hochseil standen. In diesem Band sind erstmals alle seine Gedichte versammelt, von der 1956 erschienenen Broschüre Heiße Lyrik bis hin zu dem kurz vor seinem Tod zusammengestellten Band Paradiesvogelschiß von 2008.
«Nichts Höheres möchte der Reim, als freudig mit den Ohren gelöffelt und der Seele als ein Lockruf eingeflüstert werden. Und nichts Edleres hat er im Sinn, als den Zusammenklang des tragisch Getrennten, fatal Auseinandergerissenen, umständehalber Zerteilten wenigstens für einige Atemzüge lang als möglich erscheinen zu lassen.» Peter Rühmkorf
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Doller Dichter, dieser Rühmkorf, politisch scharf, lyrisch lässig, auch mal hedonistisch und auf der Genieebene neben Heine und Ringelnatz stehend, versichert Rezensent Hilmar Klute. Sogar der Anfänger Rühmkorf zeigt sich ihm hier als kluger "Weitertreiber" von Vorbildern wie Klopstock oder Brecht. Der von Bernd Rauschenbach herausgegebene Band ist chronologisch geordnet, so der Rezensent, man kann Rühmkorfs Entwicklung also gut nachvollziehen und seine "sprachliche Aufrüstung" bewundern. Traurig macht Klute nur der Titel: Sämtliche Gedichte. Mehr kommt nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Es sind nicht in erster Linie Bilder oder irgendwelche Aussagen, die von seinem Werk hängenbleiben, sondern das unfassbare Können, das es zeigt: Peter Rühmkorfs Gedichte sind Wegweiser durch Sprach- und andere Arten von Nöten. Alles, was er zu Lebzeiten an Poesie veröffentlicht hat, bietet jetzt ein Einzelband.
Von Jürgen Kaube
Sie sei fast achtzehn, twitterte vor knapp zwei Jahren eine Kölner Schülerin, und habe "keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen." Fast selbst ein Gedicht.
Aber schon ging es los mit den Kommentaren: Ausbildung gegen Bildung, Praxis gegen Theorie, Wirtschaft gegen Kunst - und kann überhaupt jemand "Gedichtsanalysen" in vier Sprachen schreiben? Nein, recht habe die Schülerin, niemandem bringe die Reproduktion von vermeintlichem Kanonwissen etwas, der Globalisierung komme man nicht mit Mörike bei. Doch, der Nützlichkeitswahn sei selbst unnütz, Schönheit sei ein Wert und Auswendiglernen von Lyrik wichtig. Außerdem habe von Steuern doch sowieso niemand Ahnung, dafür gebe es ja Steuerberater. Am Schluss dann weise Ministerinnenworte aus Berlin: Die Schülerin habe zu Recht eine Debatte angestoßen, mehr Alltagsfähigkeiten zu vermitteln sei wichtig in der Schule, Gedichte zu lernen und zu deuten aber auch. Was an Gedichten dran ist im Gebiet jenseits der "Alltagsfähigkeiten", in dem die Ministerin ihre Lektüre stattfinden sieht, blieb allerdings offen.
Es gibt wenige deutsche Lyriker, die so wie Peter Rühmkorf in dieser Frage einschlägig sind. Denn niemand hat die Unwahrscheinlichkeit von Gedichten sowie die Frage nach der Außeralltäglichkeit des dichterischen Tons in Gedichten selbst so insistent - und fast möchte man sagen: so alltäglich - aufgenommen wie er. Dem Satz Ernst Jüngers, wer sich als Künstler selbst kommentiere, begebe sich unter das eigene Niveau, entgegnete er einst, wer Angst habe, unter sein Niveau zu gehen, kommentiere sich selbst. So gut wie jedes von Rühmkorfs Gedichten ist ein Kommentar zum Dichten selbst, notiert, wie ungewöhnlich poetische Rede ist und dass sich zwar auf einer Party sagen lässt, man sei lange Zeit früh schlafen gegangen, aber schlecht ein Gespräch mit "Einsamer nie als im August" eröffnet werden kann. Oder doch? Und was wird dann aus dem Gespräch?
Weshalb also dieses merkwürdige Sprechen? "Wir turnen in höchsten Höhen herum, / selbstredend und selbstreimend / von einem Individuum / aus nichts als Worten träumend." So heißt es in Rühmkorfs "Hochseil" von 1974, womit der außeralltägliche Bezirk ins Vertikale verlegt ist: "Wer von so hoch zu Boden blickt, / der sieht nur Verarmtes / Verirrtes. / Ich sage: wer Lyrik schreibt, ist verrückt, / wer sie für wahr nimmt, wird es." Die Verrücktheit der Produzenten als "anthropologischer Monstren" (Rühmkorf) beruht nicht nur auf ihrer Entrücktheit. Sie dokumentiert sich auch im Entschluss zu etwas, das in puncto Miete riskant ist. Wer könnte von Gedichten die Prämien zahlen, die jene artistischen Hochseilakte versichern würden, deren Publikum in jenem Gedicht erst gar nicht erwähnt wird?
Ein Leben lang, von 1955 bis zu seinem Tod im Jahr 2008, hat Peter Rühmkorf zwar nebenbei auch in anderen schreibenden Rollen gewirkt (Lektor, Rezensent, Essayist), sich an Prosa und sogar an Theaterstücken versucht, aber letztlich seine Sache doch ganz auf die Lyrik gestellt. Der vorliegende Band, der alle seine zu Lebzeiten publizierten Gedichte enthält, ist insofern auch ein Band der Reflexion über das, was Lyrik zu bieten hat. Wozu Außeralltägliches? Rühmkorfs Antwort geht über die Gedächtnisleistungen, die fürs Auswendiglernen sprechen, und über paradoxe Leerformeln wie die "Nützlichkeit des Unnützen" oder den Hinweis darauf, dass das Schöne die Mode überdauere, weit hinaus.
Die Gedichte des ganz jungen Rühmkorf - "Hier gibt's was zu verdienen: / Ich gebe Aktien aus auf meine Lyrik; / Kommt, laßt uns meine Seelenqualen abbaun!" - halten sich um 1950 herum zunächst an zeittypische Bilder: Krieg, Blechhorizont, "Dein Haar war güterwagenrot", "Motor unser, der Du bist auf Erden", die Phrasen des soeben untergegangenen Deutschlands, der historische Ruin des Homo und des sapiens. Feier und Anrufung der Helden fielen als Motive für Lyrik aus.
Schon meldet sich aber die Lust am Triumph des Reims, das Vergnügen am Können: Penis/Geschehnis, Styx/hinterrücks, Augenblicks/Archäopteryx. Später hat Rühmkorf einmal notiert, dass der Sinn viel leichter dem Laut hinterherzuschicken ist, als umgekehrt der Reim dem Gedanken. Später kommen Funde wie zermartre/Chartres, praktisch/Packtisch oder "Ober 2 Bier, 1 Sprudel und 8 Körner, / den Rest auf eigene Gefahr - / ich seh schon jetzt / was meine Fassung sprengt: / riesig dein rosa Haar / das geradewegs aus einem Bild von Turner / von See her einwärts drängt" hinzu. Kein Zufall darum, dass die Höchstleistung in dieser Disziplin sein berühmter Reim auf "Menschen" sein sollte, dem nach "Karpfen" zweitschwersten Unreimwort im Deutschen: "Die schönsten Verse der Menschen / - nun finden Sie schon einen Reim! - / sind die Gottfried Bennschen: / Hirn, lernäischer Leim -".
Kein Zufall auch Benns halber. Denn nach seinen lyrischen Anfängen ging dessen Sound dem jungen Rühmkorf lange nicht mehr aus dem Ohr. "Pilatus taucht die Hände in Lysol" ist nur eines von Dutzenden Beispielen dafür, wie Mythologie, technische Fachsprache, schnoddrige Seitenwendungen - "der Himmel wie ein Präser Gottes / über die entflammte Welt gezogen" - die Desillusion ausmalen: "Trauer kat'exochen / hinter der Blütenwehe; / Rot wie der Mund der Loren / geht der Mond in die Höhe". Zu philosophieren gibt es zwar noch viel, aber es führt zu nichts: "Liebste, ich sing: an dich / denk ich bei Tag und Nacht, / weil mich das Ding an sich / trübsinnig macht."
Was Rühmkorf dabei aus dem Bann Benns, mit dem er diesen Abstand zu Schlüsselattitüden teilt, gleich wieder herauszieht, ist, dass seine Lyrik - "wie ein verrückter Reim / leg ich mich zu dir" - sich fast immer jemandem zuwendet, zuruft, zuspricht und nur monologisiert, wenn sonst niemand Besseres da ist. Zwar schreibt er in "Namenlos" aus dem Gedichtband "Haltbar bis 1999" von 1979, mit dem er seine Tonabmischung ganz gefunden hatte, der einzige Mensch, "der echt total an dir hängt / bist du selbst". Doch das ist nicht nur eine Kombination aus Scherz, Kinderlosigkeit und ernst einbekanntem Narzissmus. Es ist auch alles andere als Stolz aufs Ich. Die Benn zugeschriebene tätowierte Innerlichkeit ist Rühmkorf ebenso fremd wie die Fähigkeit, einem Witz zu widerstehen, selbst wenn es dem einsamem Ende zugeht: "Herr Charon, zwei Lethe! / eine kleine Übersetzhilfe, / aber Lethe mit Schuß!" Eben doch immer und bis zuletzt auf der Suche nach jemandem, der mitdenkt, mitlacht.
Das Individuum, heißt es, ist unfassbar, es gibt von ihm keine Wissenschaft, Begriffe erfassen nichts Einzelnes. Hier könnte ein Unterricht ansetzen, der am Gedicht Alltagsfähigkeiten vermitteln möchte. Denn Rühmkorfs Werk ist eine einzige Probe darauf, was sich dann noch mit Worten und dem Individuum, dem alltäglichen, machen lässt.
Als nie seriös, immer ernst, hat Marcel Reich-Ranicki dieses Individuum bezeichnet, das über alle Sprachregister verfügte und alle zog. Es ist links, erotisch selten am Ende - "Liebe ist kein Feuer, ist ein Vieh" -, es singt gern, und es hat Freude am Remix: "Der Mond ist aufgegangen. / Ich, zwischen Hoff und Hangen, / rühr an den Himmel nicht. / Was Jagen oder Yoga? / Ich zieh die Tintentoga / des Abends vor mein Angesicht." Vielsprachige Gedichtanalyse in Gedichtform möchte man nennen, was Rühmkorf mit Aufklärung, Pfarrhaus, Romantik und der Liedtradition von der Ode bis zum Gassenhauer veranstaltet.
Doch auch dabei fällt er sich gleich wieder ins Wort: "Ja, ich entwickle hier noch meine eigene Klassik. / Aber auch die riecht, / zugegebenermaßen, / schon ein bißchen stark nach der Packung". Zu seinem eigenen Ton findet Rühmkorf darum Mitte der siebziger Jahre, weil er jetzt seinen Unwillen zu kollektivem und moralischem Pathos auch gegen die eigenen Positionen durchhält: "Mit der Arbeiterklasse hängt Ihr / doch auch nur noch über das Weltall zusammen". Ohrenschulung, höhere Akustik auch der niederen Geräuschwelten, Denkschallprüfung, so könnte man die Nützlichkeitsaspekte dieser Lyrik umschreiben.
Wer Rühmkorf jemals hat das Gedicht "Mit den Jahren . . . Selbst II/88" vortragen hören, versteht sofort, wie nützlich sie ist. Es setzt mit der erotischen Not des alternden Dichters ein - "Noch Seher oder schon Spanner" -, um daraus dann "kein Dings, kein Drama draus (zu) machen" und mit dem Intercity Max Stirner auf Deutschlandtour zu gehen, wo es zu einer akustischen Sprachberauschung an deutschen Ortsnamen kommt. "Semenhusen, Mönchsambach, Tröstau" gehört dabei noch zu den jugendfreiesten Zeilen. Hans Magnus Enzensbergers Unterscheidung von Oden und Kursbüchern - Erstere seien genauer -, die vorwegnahm, was am Tweet der Kölner Schülerin leider nicht diskutiert wurde, wird in diesem Rausch überflüssig. Wenn Rühmkorf sich das Kursbuch vornahm und mit ihm fertig war, ergab das eine Ode, hier an eine vollkommen neue Republik der Fleischeslust und ihrer lokalen Anrufung: "Ritziesried, Muschenheim, Strotzbüschel". Die Ode ist, um mit einem Kalauer aus seinem Band "Kunststücke" von 1961 zu sprechen, in dem in der Abteilung "Oden" Titel wie Anode, Marode, Kommode und Kathode versammelt sind, eine Methode, nämlich Gedichte hervorzubringen. Genau so hätte es Rühmkorf auch mit Mietverträgen, Steuerklärungen und Versicherungspolicen gemacht.
Hierin liegt eine der großen Leistungen dieses Werks: gezeigt zu haben, was alles aus Worten und Sätzen und Redensarten und Reimen und Gedichten gemacht werden kann, das man ihnen gar nicht ansieht. Es sind nicht in erster Linie seine Bilder oder irgendwelche Aussagen, die von ihm hängenbleiben, sondern das unfassbare Können, das es zeigt. Wir verwenden in unseren Schulen viel Zeit darauf, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie man - Gedichtanalyse! - eine gute Leserin, ein guter Leser wird. So, als gälte es, Konsumenten zu schulen.
Das Machen mit der Sprache, das Können tritt dahinter zurück oder beschränkt sich meist auf Nutztexte (Briefe, Bewerbungen, Referate und so weiter). Die Gedichte Peter Rühmkorfs rufen ihren Lesern zu: Schau her, pass auf, so geht das, hast du das schon mal gehört, kannst du das auch? In ihnen zeigt sich ein Produzent, der Probleme löst, die wir gar nicht hatten, bevor er uns die Lösung zeigte. Es geht ein unwiderstehlicher Reiz von ihnen aus, das eigene Leben nicht als Konsument zu führen. Darum vielleicht Gedichte, darum jedenfalls diese.
Peter Rühmkorf: "Sämtliche Gedichte". 1956-2008. Mit einer Auswahl der Gedichte von 1947-1955.
Hrsg. von Bernd Rauschenbach. Rowohlt Verlag, Reinbek 2016. 621 S., geb., 39,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Hierin liegt eine der großen Leistungen dieses Werks: gezeigt zu haben, was alles aus Worten und Sätzen und Redensarten und Reimen und Gedichten gemacht werden kann, das man ihnen gar nicht ansieht. Es sind nicht in erster Linie seine Bilder oder irgendwelche Aussagen, die von ihm hängenbleiben, sondern das unfassbare Können, das es zeigt. Es geht ein unwiderstehlicher Reiz von diesen Gedichten aus, das eigene Leben nicht als Konsument zu führen. FAZ.NET