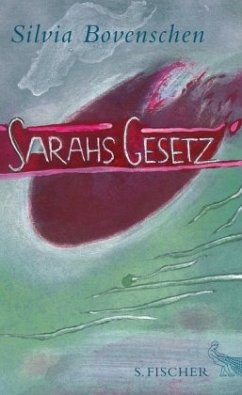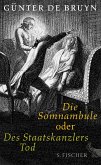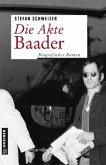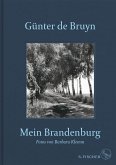Zwei Lebensgeschichten, eine gemeinsame Erinnerung. Ein Buch für die Freundin.Silvia Bovenschen erzählt von ihrer Freundin, der Malerin Sarah Schumann. Sie erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft, die seit vierzig Jahren besteht, und im Erzählen erfährt sie, was sie sonst vielleicht nie erfahren hätte. Es sind Bilder eines bewegten Lebens, Bilder von Krieg und Flucht und Rebellion. Sarah Schumann zeigt darin immer eine Haltung, manchmal dezidiert, oft hat sie etwas Wildes, aber sie ist keine Despotin, sie erlässt keine Gesetze. Sie IST das Gesetz. 'Sarahs Gesetz' ist die Hommage an eine außergewöhnliche Frau und die Geschichte einer Freundschaft. Zu endgültigen Befunden kommt es nicht. Bei aller Liebe nicht.

Ein Buch der Freundschaft, der Liebe und des Dankes, geschrieben mit Mut und Taktgefühl: Silvia Bovenschens Porträt der Malerin Sarah Schumann.
Von Monika Rinck
Sarahs Gesetz" ist ein Essay, ein gemeinsamer Lebensbericht, eine Doppelbiographie, ein zeitgeschichtlicher Dialog, ein Buch über Menschen und auch eines über Bilder - vor allem aber eine Entfaltung der Liebe und Freundschaft zwischen der Malerin Sarah Schumann und der Autorin Silvia Bovenschen. Es ist das Zeugnis einer vierzigjährigen Verbindung, von der episch, doch auf eigensinnige Weise knapp, taktvoll und entschieden, berichtet wird. Silvia Bovenschen führt das Wort, schafft den Raum und nimmt sich zuweilen aus dem Erzählen hinaus, um den Vorgang und seine Bedindungen selbst zu kommentieren. Eingefügt sind einige kursiv gesetzte Passagen, die mit dem Hinweis gekennzeichnet sind: "Sarah erzählt".
Sarah Schumann, geboren im Jahr 1933, und damit dreizehn Jahre älter als Silvia Bovenschen, erzählt klar, unverblümt und ökonomisch von ihrem Heranwachsen, den Stationen ihres Lebens, ihrer künstlerischen Entwicklung. Was sie sagt, sei Gesetz, schreibt Bovenschen, weil Schumann, eine preußische Anarchistin, nicht Gesetzgeberin oder Despotin, sondern das Gesetz selbst sei. Ihr sei die kluge Regie des gemeinsamen Lebens zugefallen, wie Bovenschen es beschreibt.
Der Fortlauf der Erinnerung ist in viele Kapitel rhythmisch moderiert, manche sind länger, andere bestehen nur aus einem Satz, einige wiederholen bereits Vorgebrachtes, sie insistieren - und entsprechen damit dem Modus eines sehr langen Gesprächs, das abbricht, aber auch wieder aufgenommen wird. "Zeitenwirbel" ist ein Kapitel überschrieben, hier in voller Länge zitiert: "Ach, das ist alles schon so lange her, und doch auch nicht." C'est ça.
Dem Buch als Motto vorangestellt sind folgende Zeilen von Ilse Aichinger: "Vielleicht beginnt das Unglück in dem Augenblick, in dem einer den anderen zu durchschauen glaubt. Solange wir wissen, dass wir unerkundbar sind, ist Liebe." Das leuchtet unmittelbar ein. Diese Atmosphäre von Zurückhaltung, in der die Distanz, selbst wo sie sich zuweilen vergrößert, nicht als Abkehr von der Freundschaft oder unausgesprochene Androhung von Entzug ausgedeutet werden muss, bleibt vom Anfang bis zum Ende des Buches erhalten. Vertrauen nährt sich von Nähe genauso wie von Ferne - womöglich stärker noch von Letzterer. Man weiß es eben nicht - aber es ist gut, daran erinnert zu werden.
Ein Mensch ist ja nicht deswegen besonders anziehend, weil er oder sie so durchschaubar wäre. Der Andere ist der Andere - die Andere ist die Andere, und muss eben dies bleiben dürfen. Es geht nicht um das Verstehen, sondern um den Mut und den Takt, die es braucht, um Sachen im Ungefähren zu lassen. Das schließt allerdings nicht aus, dass es zuweilen nötig wird, sich gegen Misrepräsentation zur Wehr zu setzen. Wer wird das besser wissen als Silvia Bovenschen, die 1979 mit ihrem Buch "Die imaginierte Weiblichkeit - Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen" eine kritische Prüfung vorgegebener Entwürfe veröffentlichte, die 2003, mehr als zwanzig Jahre später, aus weiter bestehendem Anlass, erneut aufgelegt wurde.
"Ich habe mich nicht eine Minute mit Sarah gelangweilt. Ich hätte die gesundheitlichen Zumutungen der letzten vierzig Jahre nicht durchgestanden, wenn Sarah nicht gewesen wäre." Diese beiden Sätze bilden das Kapitel "2 x die Wahrheit". Beide Hauptfiguren bleiben gesellige Einzelgänger, die nicht darauf beharren, zu einem Wir zu fusionieren. Kennengelernt haben sie sich Mitte der siebziger Jahre. Fragen der Zugehörigkeit - politischer, intellektueller und künstlerischer Natur - waren dringlich, und für Frauen noch einmal dringlicher als für Männer. So auch angesichts der Debatten, die auf die Eröffnung der Frankfurter Ausstellung "Künstlerinnen international 1877-1977" folgten, die von Sarah Schumann und sechs weiteren Frauen in Berlin organisiert worden war. Der Künstlerin Michaela Melián ist es zu verdanken, dass diese enorm wichtige und doch fast vergessene Ausstellung vor kurzem wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Das Gedächtnis ist kein friedlicher Ort. Manche Erinnerung gehen verloren, werden unterdrückt oder verdrängt, andere setzen sich durch oder kehren auf traumatische Weise immer wieder zurück. "Die Erinnerung ist ein Spuk." Künstlerische und gesellschaftliche Errungenschaften, die quer zu den Übereinkünften der herrschenden Verhältnisse stehen, gehen sehr gerne verloren. Es gilt daher, gemeinsam anzutreten gegen die "biographische Verwahrlosung", sowohl was das innere als auch was das äußerliche Archiv angeht.
Bereits in ihrem Buch "Älterwerden" (2006) berichtet Silvia Bovenschen von der Zeugenschaft langjähriger Freundschaften oder Arbeitsverhältnisse, ihr Begriff dafür ist die "Erinnerungsverabredung". "Die Sehnsucht nach Anerkennung ist vermutlich nichts anderes als der Versuch, die Interpretation der anderen zu dem, was die gemeinsame Lebensspanne geschichtsmächtig und alltagscoloriert bestimmt, mit den eigenen Erinnerungsbildern verträglich zu halten. Solide Verabredungen für eine Rahmung der individuellen Gedächtnisbilder." Es geht um eine fremde Ausdeutung des eigenen Lebens, zu der ich ja sagen kann. Kaum nötig, darauf hinzuweisen, dass man zu dieser Art von Deutung alleine nicht in der Lage ist. Man erhält sie von niemand anderem als den Anderen. Denn zum Glück des Erinnerungsaustausches, "der beständig durch die Filter aller hinzukommenden Erfahrung hindurchgetrieben, erneuert und lebendig gehalten wurde", gehören mindestens zwei.
Hier ist der Austausch wichtiger als die Definition der Gemeinschaft. Wie soll ich das nennen, was uns verbindet?, fragt Bovenschen an einer Stelle. Ist es Freundschaft oder Liebe? Es ist beides: "Ich glaube, unser Zusammensein hat von beidem das Beste. Dass eine Liebe auf die längere Dauer nur dann eine Chance hat, wenn die Freundschaft mit ihren Geboten des Vertrauens und der Verlässlichkeit dazukäme, haben vor mir schon Kluge erkannt." Dazu waren weder Versprechen noch Verpflichtungen nötig. "Wir haben uns niemals etwas versprochen, keine Schwüre, keine Beteuerungen, nicht einmal eine vage Vereinbarung."
Sarah Schumann hat im Laufe ihres gemeinsamen Lebens viele Porträts von Silvia Bovenschen gemalt, und Letztere hat über die Arbeiten Schumanns etliche Texte geschrieben, von denen einige in das Buch "Sarahs Gesetz" mitaufgenommen worden sind. Es sind Annäherungen an Tierporträts, Gespräche über Landschaftszyklen, besprochene und konkurrent ausgedeutete Landschaften, eigengesetzliche Darstellungen von Freundinnen, Porträts, die nicht insinuieren, dass der abgebildete Mensch so oder so sei, sondern vielmehr als ein visionäres Porträt darauf verweisen, "dass es möglich sei, ihn so zu sehen". Nun hat Silvia Bovenschen neben die Gemälde von Sarah Schumann ein literarisches Porträt gestellt. Das Porträt vermag "die Geheimschrift, die eine Person für die eine andere auszeichnet, ins Bild" zu setzen, schrieb sie. Das ist Silvia Bovenschen selbst nun mit der Sprache gelungen.
Die Dichterin Monika Rinck, geboren 1969, veröffentlichte zuletzt "Risiko und Idiotie" und das Hörbuch "Lieder für die letzte Runde".
Silvia Bovenschen: "Sarahs Gesetz".
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 256 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nicht weniger als die schönste Liebesgeschichte dieses Herbstes liest Rezensentin Jutta Person in Silvia Bovenschens neuem Buch "Sarahs Gesetz", das von ihrem Leben mit der Malerin Sarah Schumann erzählt. Die Kritikerin findet kaum genug Worte um ihre ganze Begeisterung für dieses Buch auszudrücken, das ihr auch als zutiefst eindrucksvolles Doppelporträt zweier Feministinnen erscheint. Sie lauscht dem persönlichen, aber nie "privatistischen" Erinnerungs-Zwiegespräch der beiden Frauen, das Bovenschen in großartig verdichteten, ebenso kunstvollen wie melancholischen Miniaturen wiedergibt, liest Schumanns Lebensgeschichte - etwa ihre Flucht vor der russischen Armee 1945 - in der gebotenen Distanz und erfährt nebenbei von der Rückständigkeit der Siebziger Jahre. Die Rezensentin attestiert der Autorin schließlich "scharfkantigen Lichtenbergschen Witz".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
'Sarahs Gesetz' ist eine intelligente und gefühlsstarke Collage von Texten über eine Malerin. Mitteldeutscher Rundfunk 201510