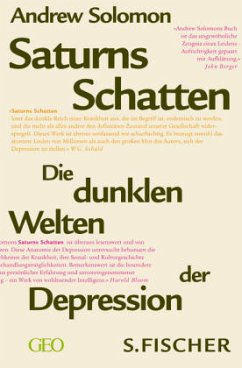Andrew Solomon ist gerade auf Lesetour mit seinem gefeierten ersten Roman, als er völlig unerwartet, gerade dreißig Jahre alt, an einer schweren Depression erkrankt. Mit ungewöhnlicher Offenheit schildert er den Verlauf seiner Krankheit. Damit gelingtes ihm, die Welt der Depression auch für Außenstehende erfahrbar zu machen. "Saturns Schatten" bietet konkrete Hilfe und Information für Betroffene, darüber hinaus gewährt Solomons Buch Einblicke in eine fremde Welt, die leider für immer mehr Menschenzur Realität wird.
Selten hat ein Autor mit so viel Verve über depressive Gefühllosigkeit geschrieben. Gerald Mackenthun, dpa-Wissenschaftsdienst
Andrew Solomon verschafft uns einen ungewöhnlichen und faszinierenden Einblick in die dunkle Seite unserer Seele. Daniel Goleman, Autor von Emotionale Intelligenz
Andrew Solomon verschafft uns einen ungewöhnlichen und faszinierenden Einblick in die dunkle Seite unserer Seele. Daniel Goleman, Autor von Emotionale Intelligenz

Psyche und Prozac: Andrew Solomon zeichnet die Landkarten eigener und fremder Depressionen / Von Michael Adrian
Nachdem die Ikonographien des genialen melancholischen Außenseiters und des Wahnsinnigen als Konformitätsopfer sich verbraucht haben, stehen wir heute, was das öffentliche Bild psychischer Erkrankungen betrifft, in einer Landschaft ohne Wegweiser und weithin sichtbare Gipfel. Ein großes Teilstück dieser Landschaft, die "dunklen Welten der Depression", hat der amerikanische Schriftsteller und Publizist Andrew Solomon vermessen. Als ein "Atlas of Depression" versteht sich sein Buch laut Untertitel der Originalausgabe. Und so kartographiert es eine erschreckend weit verbreitete und häufig gut verborgene Krankheit in umfangreichen Recherchen und Interviews, schreitet ihre Phänomenologie aus, beschreibt gängige Therapieangebote und studiert die Depressionsanfälligkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen und sozialer Schichten. Kulturspezifische Vergleiche stellt Solomon bei den Inuit in Grönland und bei den traumatisierten Opfern der Roten Khmer in Kambodscha an. Das Buch enthält einen knappen, für den damit Unvertrauten aber sehr informativen Überblick über die Geistes- und Problemgeschichte der Melancholie seit der Antike, stellt evolutionsbiologische Depressionstheorien vor und macht sich Gedanken über das Verhältnis von Gesundheitspolitik und Krankheitsdefinition. Zugleich tritt Solomon als Ein-Mann-Lobby auf und wirbt bei Betroffenen wie Nichtbetroffenen für einen realistischen Umgang mit einer nur selten restlos heilbaren Krankheit. Dazu erzählt er zahlreiche Fallgeschichten. Die interessanteste unter ihnen ist freilich seine eigene. In verschiedene Kapitel eingestreut wird sie vorgetragen; Zwiebelschicht um Zwiebelschicht glaubt der Leser in ihr Inneres vorzudringen.
"Depressionen bekam ich erst, als meine Probleme weitgehend gelöst schienen." Der Mittagsdämon, wie die Übersetzung des englischen Titels lautet, schlägt aus heiterem Himmel zu. Den Tod seiner Mutter hat der gerade Dreißigjährige überwunden und nicht ohne Erfolg einen autobiographischen Roman über diesen Einschnitt in seinem Leben veröffentlicht, als eine lähmende Gefühllosigkeit und Angst in sein Leben tritt. "Einmal merkte ich mitten auf der Autobahn plötzlich, daß ich ja gar nicht fahren konnte, und hielt schweißgebadet am Straßenrand an." Nicht lange danach ist Solomon nur noch ein hilfloses, im Bett zusammengekrümmtes Bündel, unfähig, sich zu ernähren, in unverstandener Panik angesichts einfachster Alltagsverrichtungen. Der Autor greift zu starken Bildern, um das entsetzte, gefühllose Gefühl dieser Angst zu vermitteln: Es sei, als müßte man sich ständig übergeben, ohne einen Mund zu haben.
Es sind aber nicht in erster Linie solche drastischen Gleichnisse, mit denen es "Saturns Schatten" gelingt, Schlaglichter auf die Innenwelt der Depression zu werfen. Es ist die geduldige, gelegentlich freilich auch in die kreisende Weitschweifigkeit von Krankengeschichten abgleitende Art, in der Solomon seine eigene Leidenskarriere und andere, ihm zugetragene, auslotet. Nach und nach bekommt der Leser mehr über den vermeintlich überwundenen Tod der Mutter zu hören: Unheilbar krebskrank, beging sie mit Wissen und Billigung ihres Sohnes Selbstmord. Schuldgefühle als Auslöser eines melancholischen Schubs? Eine weitere Häutung in seiner Geschichte bringt den Leser auf eine Fährte, die zu Freuds "Trauer und Melancholie" zu führen scheint, zu den nach innen gerichteten ambivalenten Gefühlen gegenüber einem abhanden gekommenen Liebesobjekt: Solomons Mutter, erfahren wir, wehrte sich entschieden gegen die homoerotische Veranlagung ihres Sohnes.
Gleichwohl ist es keine psychoanalytisch auflösbare Geschichte, die Solomon zum roten Faden macht. Interessant ist sein Buch zumal aufgrund seiner entschieden verweigerten Parteinahme für ein rein psychologisches oder ein rein biologisches Krankheitsverständnis. Die traditionelle Grenzziehung zwischen endogenen, in ihrer Ursache weitgehend unverstanden aus der Biochemie des Gehirns aufsteigenden Depressionen und solchen, die auf äußere Ereignisse reagieren, hat an Bedeutung verloren, notiert Solomon und zitiert Studien, die auf eine Verselbständigung ursprünglich reaktiver Depressionen hinweisen, auf eine wechselseitige Beeinflussung von psychosozialer und biochemischer Komponente. Leidenschaftlich plädiert sein Buch gegen einseitige Behandlungsansätze und Selbstdefinitionen und für das gesamte Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere Elektrokrampftherapien und Psychopharmaka.
Es ist dabei kein Glaube an Glückspillen, der hier verbreitet wird. Depressionen sind mit Medikamenten nicht zu heilen, wohl aber zu behandeln. An zahlreichen Fallgeschichten beobachtet er die Neigung, die Medikamentendosis eigenständig zu senken, sobald erste Erfolge eingetreten sind - und verzeichnet die schweren Rückfälle, die sich daran anschließen. Begleitende Gesprächstherapien sind also unbedingt notwendig.
Geschätzte zehn Prozent der amerikanischen Bevölkerung greifen regelmäßig zu depressionslindernden "selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern", zu denen auch das in den Vereinigten Staaten schon fast Aspirinstatus genießende Prozac gehört. Doch Psychopharmaka entfalten ihre eigene Dialektik. Solomon weist auf die Entlastung von Schuldgefühlen hin, die die Vorstellung einer rein "organischen", biochemisch zu behandelnden Krankheit haben kann. Gerade in der Fiktion einer sauberen Trennung zwischen völlig nachvollziehbarem und rein zufälligem, einer genetischen Prädisposition sich verdankendem Leid sieht Solomon die Fiktion eines "integralen, zeitbeständigen Ich" aufrechterhalten, dem die Krankheit scheinbar äußerlich bleibt. Ironisch hält der Melancholiker so an einer Autonomie fest, die Wolf Lepenies in "Melancholie und Gesellschaft" unter umgekehrtem Vorzeichen vor über dreißig Jahren formulierte: Der Empfindsame beharre darauf, " ,aus sich' heraus die Affekte zu schaffen, sein Leid selbst zu konstruieren. Nur so rettet er das Prinzip der Autonomie: für den freien Entschluß, sich selbst etwas anzutun. Bürgerliche Melancholie in Richtung auf Empfindsamkeit ist der paradoxe Versuch, endogene Melancholie zu erzeugen." Daß die Depression immer und überall ist, daß man keine Seite in der menschlichen Geschichte aufschlagen kann, ohne ihre Erscheinungsformen dahinter wimmeln zu sehen, hat gerade den herausragenden Melancholiebüchern einen Zug ins Allumfassende verliehen und sie anschwellen lassen; man denke nur an Robert Burtons "Anatomy of Melancholy" oder "Saturn und Melancholie" aus der Warburg-Schule.
Auch Solomons enzyklopädisches Buch ufert aus. Freilich ist die Begründung in seinem Fall weniger in der Sache zu sehen: Ein begnadeter Erzähler, der seine Materialfülle ökonomisch einzusetzen wüßte, ist der Autor nicht. Mancher Gedanke, manche oberflächliche Formel leider auch wiederholt sich. Auf manche Spekulation, die dem Forschungsreisenden in Sachen Depression mit ins Köfferchen geriet, hätte man gerne verzichtet - so etwa auf die Nachtgedanken zur Roten Khmer. Als Führer durch die unübersichtliche Landschaft einer sich endemisch ausbreitenden Krankheit und Gemütslage aber ist Solomons Buch willkommen. Es streitet nicht für eine große These, sondern läßt sich in freischwebend melancholischer Aufmerksamkeit so weit auf seinen Gegenstand ein, daß dieser am Ende gewissermaßen in angemessener Konturlosigkeit vor Augen steht. Solomon zitiert Tschechow: "Wenn es viele Mittel gegen eine Krankheit gibt, so kann man sicher sein, daß sie unheilbar ist." Die Frage freilich ist, ob Depression überhaupt eine Krankheit ist. Solomon vergleicht sie mit dem Husten, dem auch kein einheitliches Krankheitsbild entspricht, der zu einer Erkältung, einer Tuberkulose, einem Emphysem oder zum Lungenkrebs gehören kann. Am Ende wäre auch Depression keine rationale Krankheitskategorie, sondern ein "Symptom mit Symptomen".
Andrew Solomon: "Saturns Schatten". Die dunklen Welten der Depression. Aus dem Amerikanischen von Hans Günter Holl unter Mitarbeit von Carl Freytag. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001. 576 S., geb., 48,70 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main